von Katharina Becker, Jule Fischer, Marie Heil, Sabine Horn, Prof. Dr. Anja Schiemann, Nicole Seif und Maren Wegner
I. Einleitung
Das Projekt GeVoRe – Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte startete im November 2019 unter der Leitung von Prof. Dr. Anja Schiemann an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und wurde von August 2022 bis November 2023 an der Universität zu Köln fortgeführt. Ziel war es, die Auswirkungen des 52. Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches[1] auf Täter:innen, Opfer und Strafverfolgungsbehörden zu untersuchen. Dabei wurde die alte Rechtslage der Novellierung gegenübergestellt[2] und untersucht, inwieweit das gesetzgeberische Ziel einer Verbesserung der Strafverfolgung und einer höheren Bestrafung der Täter:innen erreicht wird. Des Weiteren wurden unterschiedliche Positionen innerhalb von Diskursen über Gewaltanwendung analysiert und ein Fokus auf die Untersuchung von Eskalationsprozessen zwischen der Polizei und ihrem Gegenüber gelegt. Der Frage nach der Sinnhaftigkeit der intendierten kriminalpolitischen Ausrichtung des Gesetzes wurde mittels Expert:inneninterviews mit Staatsanwält:innen, Strafrichter:innen und Strafverteidiger:innen nachgegangen, deren Befunde mit einer Aktenanalyse von Urteilen und Verfahrenseinstellungen verglichen wurden. Die im Rahmen des interdisziplinären Ansatzes erlangten Erkenntnisse sollen zur Erweiterung der phänomenologischen und ätiologischen Kenntnisse zu Übergriffen beitragen. Der Forschungsbericht enthält neben einer Beschreibung der Studie der zugrundeliegenden Methodik auch die Ergebnisse aus den einzelnen Forschungsteilabschnitten. Insgesamt werden die Auswirkungen der Gesetzesänderung der §§ 113, 114, 115 StGB auf Täter:innen, Opfer und die Strafverfolgungsbehörden qualitativ im Sinne einer evidenzbasierten Kriminalpolitik evaluiert, um so die Effizienz der erfolgten Gesetzesänderung zu beurteilen und einen Beitrag zu den aktuellen politischen Zielsetzungen zu leisten, die Widerstandsdelikte einer erneuten Strafschärfung zuzuführen.[3]
II. Methodik
1. Methodische Grundlagen
Das Forschungsprojekt basiert auf einem qualitativen Forschungsdesign, das punktuell durch quantifizierende Analysen ergänzt wurde. Die Analyse der Interaktionsdynamiken basiert auf subjektiven Erfahrungsbeschreibungen und orientiert sich explorativ an den Prinzipien der Grounded Theory Methodology[4]. Dabei wurde das Vorgehen reflexiv-rekursiv ausgerichtet. Die Erhebung, die Analyse und die Theoriebildung greifen ineinander über und wurden nicht nur sequentiell vorgenommen. Durch das entdeckende Vorgehen und die theoriegestützte Erkenntnisproduktion[5] konnte eine offene Haltung der Forschenden zum Forschungsgegenstand und dem erhobenen Material unter Rückgriff auf theoretische Kenntnisse aus dem Forschungsfeld[6] gewährleistet werden.
Die Annäherung an die Forschungsfragen zu Gewalt erfolgte über eine Analyse von fachlichen, spezifischen und gesellschaftlichen Diskursen über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Hinsichtlich der Interaktionsdynamiken spielte neben den äußeren Rahmenbedingungen des Einsatzgeschehens wie Einsatzanlass, Merkmale und Handlungen der Konfliktparteien auch die emotionale Dynamik eine Rolle, die von einem Wechselwirkungsverhältnis aus Konfrontationsanspannung und -angst geprägt ist.[7] Mit der anschließenden Verfahrensaktenanalyse konnten die jeweiligen Handlungen der Konfliktparteien auf wiederkehrende Muster untersucht werden. Zu berücksichtigen war hier jedoch eine eingeschränkte Aussagekraft, da durch die chronologische Rekonstruktion einer als strafrechtlich relevant eingeordneten Handlung die eigene Sichtweise perpetuiert wird und die Polizei zugleich in einer Doppelrolle agiert: Sie ist sowohl Konfliktpartei mit einer spezifischen situativen Wahrnehmung als auch Akteurin der Strafverfolgung, die durch Auswahl, Kategorisierung und sprachliche Darstellung den Gehalt der Verfahrensakten maßgeblich prägt. Daher wurde die Methodik um problemzentrierte Interviews ergänzt, in denen die Konfliktparteien hinsichtlich Wahrnehmungen, Empfindungen, Motiven und erlebter Gewalterfahrungen bzw. Gewaltanwendung befragt wurden. Einschränkend ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich beide Datenquellen nur in Einzelfällen auf denselben Sachverhalt beziehen.[8] Mit Hilfe der Verfahrensaktenanalyse von Urteilen, Einstellungen und Freisprüchen wurden ebenso die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Praxis der Strafverfolgung untersucht. Expert:inneninterviews mit Vetreter:innen der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft, der Strafverteidigung sowie mit Einsatzkräften der Polizei und der Rettungsdienste ergänzten die Dokumentenanalyse um gezielte Fragen nach Problematiken, Entwicklungen und Handlungsempfehlungen aus der Praxis heraus.
2. Feldzugang
a) Aktenanalyse
Die Ermittlung der auszuwertenden Verfahrensakten bzgl. der Verurteilungen erfolgte über eine Anfrage beim Bundesamt für Justiz. Auf dieser Grundlage konnte eine Vollerhebung aller abgeschlossener Verfahren, die einen Verstoß gegen die §§ 113, 114 und/oder 115 StGB im Erhebungszeitraum (2015 bis 2020) betrafen, vorgenommen werden. Aus dieser Grundgesamtheit an Verfahrensakten wurde auf Basis eines theoretischen Samplings eine eingeschränkte Zufallsauswahl (Klumpenstichprobe) getroffen: Im Rahmen der Auswahlstrategie wurden sowohl Fallkonstellationen bestimmt, die auf Grundlage kriminalstatistischer Lagebilder und bestehender Forschung als besonders relevant erschienen, als auch juristische Paramater ausgewählt, die eine Rolle spielen. Das Ziel bestand darin, eine möglichst breite inhaltliche Varianz der untersuchten Verfahren abzubilden. Die Verfahrensakten wurden mithilfe des staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichens bei den einzelnen Staatsanwaltschaften angefragt.
Grenzen dieses Zugangs liegen in der Tatsache, dass das Bundeszentralregister nur strafgerichtliche Verurteilungen aufführt, nicht jedoch Freisprüche und Einstellungen. Insofern war hierzu eine Abfrage beim Bundesamt für Justiz nicht möglich. Daher wurden für die Einholung der Verfahrensakten zu Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen zunächst die Justizministerien der Bundesländer angefragt, die nach erfolgter Zustimmung die Anfrage weiter an die Generalstaatsanwaltschaften delegierten. Die Auswahl der übersandten Verfahrensakten erfolgte durch die Staatsanwaltschaften nach dem Zufallsprinzip. Aus dieser entstandenen Klumpenstichprobe wurden sodann Akten durch eine eingeschränkte Zufallsauswahl ausgewählt. Nach einer ersten Sichtung ließen sich solche aussortieren, bei denen der Ausgang des Verfahrens nicht ersichtlich war oder aus anderen Gründen die Akten unvollständig und für die Analyse nicht verwertbar waren.
Am Ende lag ein Datensatz von 120 Strafverfahrensakten zu den Verurteilungen zugrunde. Hinsichtlich der Verfahrenseinstellungen und Freisprüche übersandten die Staatsanwaltschaften 181 Akten. Auch hier wurde eine erste Sichtung vorgenommen und die Akten für die spätere Auswertung digitalisiert. Am Ende konnte dieser zweite Datensatz – bestehend aus 60 Strafverfahrensakten – mit dem ersten Datensatz verbunden werden.[9] Anonymisiert wurden soziobiografische und weitere Angaben der Tatverdächtigen und der Geschädigten quantitativ erfasst. Im Anschluss daran folgte eine Kategorisierung des Alters, BAK-Wertes etc. Für die Erarbeitung von Zusammenhängen und Interaktionsmustern sowie für die thematische Strukturierung wurde ein Codiersystem entwickelt und anschließend mit Hilfe von Auswertetabellen umgesetzt. Mehrfachzuordnungen wurden dabei ausgeschlossen, um Verzerrungseffekte zu vermeiden. Dieses Vorgehen eignete sich, um einen bestmöglichen Überblick über die Daten aus den Verfahrensakten zu erlangen.
Zur Erhebung der Auswirkungen der Änderung der §§ 113 ff. StGB auf die Strafzumessungspraxis, wurde die Aktenanalyse in die Fälle unterteilt, die sich vor und diejenigen, die sich nach der Gesetzesänderung ereigneten. Insgesamt ergab sich so eine Vergleichsgruppe von 72 Fällen vor und 108 Fällen nach der Reform.[10]
b) Interviews
Des Weiteren wurden im Projekt GeVoRe Expert:inneninterviews sowie problemzentrierte Interviews geführt. Beide waren leitfadengestützt, wobei die Themenschwerpunkte mit groben Abschnitten vorgegeben waren. Im Übrigen waren die Fragen offen gestellt, so dass jede:r Interviewte umfangreich Erfahrungen und Meinungen beisteuern konnte. Für die Expert:inneninterviews wurden Gesprächspartner:innen gesucht, die beruflich mit dem Themenkomplex Gewalt gegen Einsatzkräfte zu tun hatten und daher eine gewisse Expertise aus dem Berufsfeld vorweisen konnten. Für die problemzentrierten Interviews wurden Gesprächspartner:innen rekrutiert, die bereits Teil einer konfliktträchtigen Interaktion zwischen Zivilbevölkerung und Polizei oder Rettungskräften wurden und so ihre subjektive Sichtweise auf die Interaktion schildern konnten. Während die problemzentrierten Interviews vor Ort, Face to Face geführt wurden, fanden die Expert:inneninterviews telefonisch statt. Über die Innen- und Justizministerien konnten insgesamt 78 Expert:innen für ein Interview gewonnen werden.[11] Alle geführten Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und im Anschluss zur weiteren Analyse transkribiert. Aufgrund einer inhaltlichen Sättigung im Bereich der problemzentrierten Interviews mit Polizeibeamt:innen wurden von den 69 geführten nur 27 Interviews mithilfe der Software MAXQDA codiert und ausgewertet.[12] Methodisch ist zu berücksichtigen, dass die Rekrutierung von Personen, gegen die als Beschuldigte ein Strafverfahren eingeleitet wurde, für problemzentrierte Interviews nur eingeschränkt möglich war. Diese Perspektive ist daher in der Datengrundlage deutlich unterrepräsentiert, während die Sichtweisen von Polizeibeamt:innen und Rettungskräften aufgrund institutioneller Zugänge und höherer Gesprächsbereitschaft zahlenmäßig dominieren. Dies führt zu einer gewissen Asymmetrie in den erhobenen Daten und schränkt die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Konfliktperspektiven ein. Zugleich verdeutlicht es aber auch die Relevanz der methodischen Triangulation mit Verfahrensakten und Expert:inneninterviews, um das Forschungsthema aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfassen.
III. Die rechtliche Seite – Widerstandsdelikte im Überblick
Während der Projektlaufzeit trat am 1.7.2021 das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität in Kraft,[13] wodurch der persönliche Anwendungsbereich des § 115 Abs. 3 StGB und damit der §§ 113, 114 StGB um Hilfeleistende eines ärztlichen Notdienstes und einer Notaufnahme erweitert wurde. Diese Änderung war aufgrund des Projektbeginns bereits im November 2019 nicht Gegenstand der Forschung, so dass der Überblick sich auf die durch das 52. Änderungsgesetz begründete Fassung der §§ 113-115 StGB bezieht.
1. § 113 StGB – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
§ 113 StGB schützt neben der Vollstreckungstätigkeit nach herrschender Meinung auch die vollstreckenden Personen.[14] Durch den Schutz der Vollstreckungstätigkeit an sich soll die Autorität staatlicher Vollstreckungsakte und damit auch das Gewaltmonopol des Staates geschützt werden.[15] Ob darüber hinaus auch die Vollstreckungsbeamt:innen selbst vom persönlichen Schutzbereich erfasst sind, ist in Bezug auf § 113 StGB umstritten,[16] jedenfalls aber bezüglich des neuen § 114 StGB anerkannt[17] und auch vom Gesetzgeber so vorgesehen.[18]
Geschützte Personen gem. § 113 StGB sind Amtsträger:innen sowie Soldat:innen der Bundeswehr, die zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen sind. Die Amtsträgereigenschaft ergibt sich aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Die im Rahmen der Studie in den Blick genommenen Polizeivollzugsbeamt:innen sind Amtsträger:innen im Sinne der Norm[19] und in der Praxis neben Gerichtsvollzieher:innen auch am meisten von diesem Delikt betroffen.[20]
Der sachliche Schutzbereich ist aber funktional dahingehend eingegrenzt, dass die in § 113 StGB genannten Personen nur bei der Vornahme einer Vollstreckungshandlung geschützt sind. Es ist also nur die gezielt hoheitliche Maßnahme, die konkrete Vollstreckungssituation im jeweiligen Einzelfall vom Schutzbereich erfasst.[21] Da es um gezielte Vollstreckungsmaßnahmen geht, sind schlichte Überwachungs- und Ermittlungstätigkeiten nicht geschützt.[22] Ebenfalls ausgenommen sind Diensthandlungen wie der allgemeine Streifendienst der Polizei oder die präventiv-beobachtende Tätigkeit durch Polizeivollzugsbeamt:innen.[23] Allerdings kann die Ermittlungstätigkeit von Polizeivollzugsbeamt:innen durchaus in eine Vollstreckungstätigkeit übergehen und dann unter den Schutzbereich fallen. Dies ist der Fall, wenn die Polizeivollzugsbeamt:innen aufgrund auftretender Verdachtsmomente oder zur Abwehr konkreter Gefahren dazu ansetzen, gegen eine bestimmte Person oder Sache vorzugehen.[24] Daneben sind repressive Ermittlungsmaßnahmen ebenfalls den Vollstreckungshandlungen zuzurechnen, also beispielsweise Durchsuchungen, Sicherstellungen, unmittelbarer Zwang zur Durchsetzung einer Blutentnahme und erkennungsdienstliche Maßnahmen.[25] In zeitlicher Hinsicht muss die Vollstreckungshandlung schon begonnen haben oder zumindest unmittelbar bevorstehen und darf noch nicht beendet sein.[26]
Seit der Neufassung durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz 2017 wird in § 113 StGB als Tathandlung nur noch das Widerstandleisten in Form von Gewalt oder Drohung mit Gewalt erfasst, während der tätliche Angriff aus § 113 StGB herausgelöst und in § 114 StGB eigenständig geregelt wurde. Widerstandleisten ist das aktive, gegen Vollstreckungsbeamt:innen gerichtete Verhalten, das zumindest nach der Vorstellung des Täters oder der Täterin geeignet ist, die Vollstreckungshandlung zu vereiteln oder zu erschweren.[27] Täter:in kann jedermann sein, also nicht nur die von der Diensthandlung betroffene Person.[28] Rein passiver Widerstand ist zur Deliktsverwirklichung nicht ausreichend.[29]
Der Gewaltbegriff in § 113 StGB wird restriktiver ausgelegt als in § 240 StGB. Er ist auf den Einsatz physisch wirkender Zwangsmittel beschränkt, der gegen die Person des:der Vollstreckungsbeamt:in gerichtet und geeignet ist, den Vollzug der Vollstreckungshandlung zu erschweren oder zu verhindern.[30] Damit sich der Unrechtsgehalt des Widerstands nicht im schlichten Ungehorsam erschöpft, bedarf es einer aktiven, mittelbar oder unmittelbar gegen den/die Vollstreckungsbeamt:in gerichteten Kraftäußerung.[31] Der körperliche Krafteinsatz gegen Sachen reicht dann aus, wenn er mittelbar auf die Vollstreckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten einwirkt.[32] Von einem gewaltsamen Widerstand kann jedenfalls dann nicht gesprochen werden, wenn der Betroffene lediglich seine Mitwirkung an der Vollstreckungshandlung verweigert, also beispielsweise sein eigenes Körpergewicht entgegensetzt oder seine Arme unter dem Körper verbirgt.[33] Auch das Festkleben am Boden wäre an sich nicht erfasst.[34] Dagegen wurde in Abgrenzung zum passiven Widerstand Gewalt bejaht, wenn der Betroffene nicht nur das Gewicht seines Körpers der Vollstreckungshandlung entgegensetzt, sondern dem/der Vollstreckungsbeamt:in darüber hinausgehende Schwierigkeiten bereitet, wie durch Entgegenstemmen, heftiges Sträuben gegen einen Abtransport oder Losreißen mit nicht unerheblichem Kraftaufwand aus einem Festhaltegriff. [35] Ein reines Sich-Entziehen aus dem lockeren Griff eines/einer Polizeivollzugsbeamt:in ist dagegen nicht ausreichend.[36] Fischer stellt aber zutreffend fest, dass die tatrichterliche Praxis bei der Feststellung von Gewalt, insbesondere soweit es sich um Verhaltensweisen gegenüber Polizeivollzugsbeamt:innen handelt, oft sehr großzügig ist.[37]
Im Gegensatz zu § 240 StGB erfasst § 113 StGB nur die Drohung mit Gewalt, also die Ankündigung zukünftiger Gewaltanwendung im eben erläuterten restriktiven Sinn und nicht die Drohung mit sonstigen empfindlichen Übeln.[38] Die Drohung kann nicht nur verbal, sondern auch konkludent durch bedrohliche Gesten erfolgen.[39]
Gem. § 113 Abs. 3 StGB entfällt die Strafbarkeit, wenn die Diensthandlung der:des Amtsträger:in nicht rechtmäßig war.[40] Rechtsprechung und der überwiegende Teil der Literatur vertreten einen strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff.[41] Danach kommt es nicht auf die materielle Richtigkeit, sondern allein auf die formelle Rechtmäßigkeit an.[42] Hierzu muss die betreffende Diensthandlung in den sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich des:der Amtsträger:in fallen, die wesentlichen Förmlichkeiten müssen eingehalten worden sein und die Vollstreckungshandlung muss auf einer gesetzlichen Eingriffsermächtigung beruhen.[43] Soweit der:die Amtsträger:in die Voraussetzungen unbestimmter Rechtsbegriffe zu prüfen oder Ermessen auszuüben hat, ist es ausreichend, wenn er sich verantwortungsbewusst um ein pflichtgemäßes Vorgehen bemüht.[44]
In subjektiver Hinsicht ist ausreichend, wenn der:die Täter:in hinsichtlich der in § 113 Abs. 1 StGB genannten Merkmale mit bedingtem Vorsatz handelt. Auf die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung muss sich der Vorsatz nicht beziehen, da diese nicht Bestandteil der Tatbestandsmäßigkeit ist.[45] Irrtümer über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der Diensthandlung sind explizit in § 113 Abs. 3 S. 2 und Abs. 4 StGB geregelt. So entlastet nach § 113 Abs. 3 S. 2 StGB die fehlende Rechtmäßigkeit der Diensthandlung den:die Täter:in auch dann, wenn er:sie sie irrtümlich für rechtmäßig erachtet. Die irrtümliche Annahme der Rechtswidrigkeit ist in § 113 Abs. 4 StGB geregelt. War die irrige Annahme der Rechtswidrigkeit der Diensthandlung vermeidbar, so kann das Gericht gem. §§ 113 Abs. 4 S. 1, 49 Abs. 2 StGB die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder bei geringer Schuld des:der Täter:in von einer Bestrafung aus § 113 StGB ganz absehen. Bei unvermeidbarem Irrtum wird der:die Täter:in gem. § 113 Abs. 4 S. 2 StGB gar nicht bestraft, es sei denn, es war ihm:ihr nach den Umständen zuzumuten, sich mit Rechtsbehelfen gegen die Diensthandlung zu wehren.
§ 113 StGB sieht für den Regelfall einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. In besonders schweren Fällen nach Abs. 2 wird der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren angehoben. Ein besonders schwerer Fall ist in der Regel gegeben, wenn eines der Fallbeispiele erfüllt ist. § 113 Abs. 2 Nr. 1 StGB setzt voraus, dass „der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt“. Während vor der Reform für die Erfüllung des Regelbeispiels außerdem die Absicht erforderlich war,[46] die Waffe oder das andere gefährliche Werkzeug bei der Tat zu verwenden, wurde die Verwendungsabsicht mit dem 52. Gesetz zur Änderung des StGB gestrichen.[47] Kritisiert wird insofern, dass sich so die Auslegungsprobleme des ebenfalls auf die Verwendungsabsicht verzichtenden § 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB auf das Regelbeispiel in § 113 Abs. 2 Nr. 2 übertragen hätten.[48] Es reicht also aus, wenn der:die Täter:in oder ein anderer an der Tat Beteiligter die Waffe oder das Werkzeug während der Tatbegehung bei sich führt. Der Begriff der Waffe wird in einem strafrechtlichen, vom Waffenrecht grds. unabhängigen Sinne verstanden. Davon werden neben den Schusswaffen, Luftdruck- und Gaspistolen auch sonstige Waffen im technischen Sinn erfasst, wie bspw. Hieb- und Stoßwaffen, aber auch Pfefferspraygeräte.[49] Aufgrund der Waffenähnlichkeit des gefährlichen Werkzeugs wird gefordert, dass das Werkzeug abstrakt gefährlich ist, es muss also objektiv gefährlich, d.h. auf Grund seiner objektiven Beschaffenheit geeignet sein, bei entsprechender Verwendung erhebliche Verletzungen herbeizuführen.[50] Ausreichend ist, dass die Waffe oder das Werkzeug zu irgendeinem Zeitpunkt während der Widerstandshandlung bis zu deren Vollendung ergriffen werden sollen.[51]
Das Regelbeispiel in § 113 Abs. 2 Nr. 2 StGB setzt voraus, dass „der Täter durch Gewalttätigkeit den Angegriffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt“. Der Begriff der Gewalttätigkeit erfasst nur eine unmittelbar gegen die Person entfaltete physische Aggression.[52] Die konkrete Leib- oder Lebensgefahr muss von einem bedingten Gefährdungsvorsatz getragen sein.[53]
Neu eingefügt durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz wurde das Regelbeispiel Nr. 3, nach dem „die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen“ sein muss. Hierunter versteht man nicht nur mittäterschaftliches Zusammenwirken, sondern auch schwächere Beteiligungsformen jedenfalls dann, wenn der:die Gehilf:in am Tatort anwesend ist und bewusst die Position des:der Widerstand leistenden Täter:in verstärkt.[54]
2. § 114 StGB: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
Wie bereits erwähnt, wurde mit der Gesetzesänderung 2017 der tätliche Angriff aus § 113 StGB herausgelöst und mit § 114 StGB in eine eigenständige Regelung überführt. § 114 StGB a.F. wurde in § 115 StGB verschoben und neu gefasst.
Der neue Straftatbestand des tätlichen Angriffs möchte „Respekt und Wertschätzung“ der Betroffenen zum Ausdruck bringen und dient dem besonderen Schutz der Vollstreckungsbeamt:innen bei allgemeinen Diensthandlungen.[55] Daher verzichtet § 114 StGB auf den in § 113 StGB erforderlichen Bezug zu einer konkreten Vollstreckungshandlung.[56] Der Begriff der Diensthandlung umfasst auch Handlungen, die als schlichte Ausübung des Dienstes nicht darauf abzielen, den staatlichen Willen notfalls mit Mitteln des hoheitlichen Zwangs gegenüber bestimmten Personen durchzusetzen.[57] Der Begriff ist also denkbar weit und erfasst jede von einem Hoheitsträger in dienstlicher Eigenschaft durchgeführte Handlung.[58] Dazu gehören bspw. Ermittlungstätigkeiten jeder Art, Streifenfahrten, Reifenkontrollen, Unfallaufnahmen, Beschuldigtenvernehmungen, Befragung von Personen, Beobachtungen gewaltbereiter Personen und beschützende Begleitung von Demonstrationszügen.[59] Daneben zählen selbstverständlich auch Vollstreckungshandlungen zum Tatbestand, da diese gleichermaßen eine Diensthandlung darstellen.[60]
Der tätliche Angriff muss „bei einer Diensthandlung“, also während der Dauer der Diensthandlung erfolgen. Die Zeitspanne reicht vom Beginn des dienstlichen Verhaltens bis zu seinem vollständigen Abschluss.[61]
Unter dem Begriff des tätlichen Angriffs verstand man im Rahmen des § 113 StGB die unmittelbar auf den Körper zielende feindselige Einwirkung, die nicht unbedingt zum Eintritt eines Körperverletzungserfolgs geführt haben muss.[62] Diese Auslegung wird von Teilen der Literatur für die Neufassung der Norm aufgegeben. Aufgrund der erheblich erhöhten Strafdrohung, der veränderten Schutzrichtung und systematischen Erwägungen, sei eine restriktive Auslegung geboten. Hiernach seien vom tätlichen Angriff nur solche Handlungen erfasst, die konkret geeignet sind, die Rechtsgüter auch tatsächlich und nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen.[63] Auch andere fordern feindselige Einwirkungen „von einigem Gewicht“.[64] Der BGH ist dieser Auffassung nicht gefolgt und hält an der bisherigen Definition des tätlichen Angriffs fest.[65] Er beruft sich auf den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, der im fortgeltenden Wortlaut der Norm seinen Ausdruck gefunden habe.[66]
Ist die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung, findet § 113 Abs. 3 und 4 StGB über § 114 Abs. 3 StGB entsprechende Anwendung mit der Folge, dass diese dann rechtmäßig sein muss. Ist sie es nicht, so entfällt die Strafbarkeit. Auch die Irrtumsregelungen gelten entsprechend. Dagegen ist ein tätlicher Angriff gegen eine allgemeine Diensthandlung, die nicht auch Vollstreckungshandlung ist, selbst dann strafbar, wenn die Diensthandlung unrechtmäßig war.[67] Hier kommen ggf. nur die allgemeinen Rechtfertigungsgründe der §§ 32, 34 StGB in Betracht.
Ebenso wie bei § 113 StGB ist in subjektiver Hinsicht dolus eventualis hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale erforderlich.[68] Gem. § 114 Abs. 2 StGB finden die Regelbeispiele nach § 113 Abs. 2 StGB entsprechend Anwendung.
3. § 115 StGB: Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen
§ 115 StGB enthält keinen eigenständigen Straftatbestand, sondern dehnt den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf weitere Personengruppen aus, die den Vollstreckungsbeamt:innen gleichgestellt werden.[69] Insofern wurde § 114 StGB a.F. durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz in § 115 StGB überführt und an die erfolgten Änderungen der §§ 113, 114 StGB angepasst.[70] Die erneute Ausweitung des persönlichen Anwendungsbereichs durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität war nicht Gegenstand des Forschungsprojekts GeVoRe.
§ 115 Abs. 1 StGB erstreckt den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf Vollstreckungshandlungen von Personen ohne Amtsträgereigenschaft i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB, die die Rechte und Pflichten eines:einer Polizeivollzugsbeamt:innen haben oder Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind.[71] Die von § 115 Abs. 1 StGB erfassten Personen müssen im Rahmen ihrer Befugnisse eine Vollstreckungshandlung ausgeführt haben.[72]
Nach § 115 Abs. 2 StGB wird der Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf Personen erweitert, „die zur Unterstützung bei der Diensthandlung hinzugezogen sind“. Dies betrifft Verwaltungshelfer:innen, die auf Grund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung von Vollstreckungsbeamt:innen unterstützend tätig werden.[73]
§ 115 Abs. 3 StGB bildet einen eigenen Tatbestand, der lediglich in Bezug auf die Rechtsfolgen auf §§ 113, 114 StGB verweist.[74] Hiernach sind die §§ 113, 114 StGB auch dann anwendbar, wenn Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes i.S.d. § 113 StGB behindert oder gem. § 114 StGB tätlich angegriffen werden.[75] Der Schutzbereich erfasst neben Mitarbeiter:innen des Katastrophenschutzes, Mitarbeiter:innen sowohl der Berufs- als auch der freiwilligen Feuerwehr, bei Mitarbeiter:innen von Betriebsfeuerwehren wird gefordert, dass diese an Einsätzen im öffentlichen Bereich beteiligt sind.[76] Bei den Rettungsdiensten werden Einsatzkräfte des öffentlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungsdienstes geschützt.[77] Das Projekt GeVoRe hat zur Evaluation des § 115 StGB ausschließlich Vorfälle gegen Mitarbeiter:innen der Feuerwehr und des Rettungsdiensts in den Blick genommen.
Für eine Strafbarkeit gem. § 115 Abs. 3 StGB ist in funktionaler Eingrenzung erforderlich, dass die Tätigkeit der geschützten Person im Rahmen eines Unglücksfalls, einer gemeinen Gefahr oder gemeinen Not stattfindet. Zur Auslegung der Begriffe kann auf § 323 c StGB verwiesen werden.[78] Ferner muss die geschützte Person Hilfe leisten, worunter die konkrete Einsatztätigkeit in einer der genannten Situationen verstanden wird.[79] Als Tathandlung wird vorausgesetzt, dass der:die Täter:in die durch § 115 Abs. 3 StGB geschützte Person bei der Hilfeleistung mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt behindert oder sie in solchen Situationen tätlich angreift. Zu den Tatmitteln Gewalt und Drohung mit Gewalt kann auf die Ausführungen zu § 113 StGB verwiesen werden. Unter einer Behinderung versteht man jede spürbare, nicht unerhebliche Störung der Rettungstätigkeit. Die Behinderung muss also in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Hilfeleistung stehen.[80] Zum Begriff des tätlichen Angriffs kann auf § 114 StGB verwiesen werden.
Auch wenn vom reinen Wortlaut her der:die Hilfsbedürftige selbst als Täter:in in Betracht kommt, nehmen Teile der Literatur im Rahmen einer teleologischen Reduktion diese vom Tatbestand aus. Denn § 115 Abs. 3 StGB schütze nicht nur den:die Helfer:in, sondern auch die Individualrechtsgüter der Hilfsbedürftigen.[81] Dieser einschränkenden Auslegung ist zuzustimmen.
In subjektiver Hinsicht muss der:die Täter:in mit bedingtem Vorsatz handeln, der sich sowohl auf die Gefahren- oder Schadenslage als auch die Zugehörigkeit der betroffenen Personen zu einem der genannten Schutz- oder Rettungsdienste bezieht.[82]
IV. Interaktionsdynamiken
Der erste Fokus in GeVoRe lag auf der Untersuchung von Eskalationsprozessen. Die Erkenntnisse zur Interaktion wurden in zwei Schritten gewonnen. Im ersten Schritt erfolgte die Gesamtschau der Verfahrensaktenanalyse hinsichtlich unterschiedlicher Parameter, insbesondere objektiver Kriterien, wie bspw. situative Merkmale und Einsatzanlässe. Sichtbare Merkmale der Konfliktparteien waren den Zeugenaussagen der beteiligten Einsatzkräfte zu entnehmen. Allerdings erfolgt die Darstellung in Verfahrensakten, abgesehen vom Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes, orientiert an objektiven Kriterien, sodass subjektive Prozesse wie Stimmungen, Emotionen und Gedanken nur in seltenen Fällen als Information Eingang in die Ermittlungsakte finden. Daher wurden in einem zweiten
Schritt die problemzentrierten Interviews anhand der am Fragebogen orientierten Codes auch hinsichtlich subjektiver Kriterien ausgewertet.
1. Situative Gegebenheiten bei Eskalationen
Die hervorgehenden situativen Gegebenheiten decken sich weitestgehend mit der Studienlage, die die Charakteristika von Übergriffsituationen beleuchten.[83] Die meisten Einsatzanlässe im Wach- und Wechseldienst bzw. Streifendienst erfolgten aufgrund der Mitteilung eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts, der im privaten oder öffentlichen Raum stattfand. Das Deliktsfeld der gemeldeten Straftaten war breit, häufig gingen jedoch Körperverletzungsdelikte dem reaktiven Einschreiten der Einsatzkräfte voraus. Bei großen Einsatzlagen dominierten versammlungsspezifische Gefahren und gruppendynamische Prozesse als Auslöser der Gewaltanwendung. Insbesondere in den Bürger:inneninterviews wurde bei Demonstrationen am häufigsten von Eskalationen berichtet. Hintergrund hierbei waren neben Gegenprotesten anlässlich rechtsextremistischer Aufmärsche, Versammlungen im Kontext umweltbezogener Themen. Zu eskalativen Maßnahmen kam es bei oder infolge der Durchführung von Festnahmen, Räumungen, Identitätsfeststellungen, Ingewahrsamnahmen, körperlichen Durchsuchungen und Wohnungsdurchsuchungen, Platzverweisen oder Sicherstellungen. Betrachtet man die Perspektive der Einsatzkräfte, so stellt sich gesamtheitlich betrachtet zum einen die Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und zum anderen die Erstversorgung im Rahmen eines Rettungseinsatzes als häufigster Einsatzanlass heraus.
Im Rahmen der Verfahrensaktenanalyse zeigte sich, dass 80 % der Beschuldigten in einem Strafverfahren zu Widerstandsdelikten männlich, und etwa 40 % vorbestraft waren. Auch war der größte Anteil Beschuldigter mit ca. 42 % unter 30 Jahre alt und damit jüngeren Alters. Im Rahmen der problemzentrierten Interviews konnte das männliche Geschlecht ebenfalls als Risikofaktor für Widerstandsdelikte identifiziert werden. Auf Seiten der Geschädigten war ein ähnlicher Befund festzustellen. 36 % waren unter 30 Jahre und 29 % zwischen 30 und 40 Jahre alt. Auch hier dominierte das männliche Geschlecht (77 %), wobei am häufigsten Einsatzkräfte der Polizei (80 %) aus allen Organisationseinheiten (Bereitschafts-, Schutz-, Kriminalpolizei) betroffen waren, am häufigsten jedoch Polizeibeamt:innen aus der Bereitschaftspolizei (insbesondere Einsatzhundertschaft) oder der Bundespolizei. Etwas differenzierter hingegen zeigte sich das Bild bei den problemzentrierten Interviews. Hier wurde häufiger von Eskalationen im Rahmen des Streifendienstes berichtet.
2. Gewaltverständnis und die Rolle von Autorität und Respekt
Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens proklamierten Befürworter:innen der Gesetzesreform einerseits eine Zunahme von Gewalt anderseits eine zunehmende Respektlosigkeit.[84] Vor diesem Hintergrund wurde besonders das subjektive Begriffsverständnis von Gewalt und die Rolle von Autorität und Respekt durch die problemzentrierten Interviews untersucht.
Alle befragten Einsatzkräfte fassten jede Einwirkung auf den Körper des:der Betroffenen (bspw. auch das Anspucken) als Gewalt auf, ohne dass es hierfür einer Zwangslage auf der anderen Seite bedürfe. Dieses Verständnis geht über das restriktivere juristische Gewaltverständnis des § 113 StGB hinaus, nach welchem die Handlung zusätzlich noch geeignet sein muss, den Vollzug der Vollstreckungshandlung zu erschweren oder zu verhindern.[85] Einige Einsatzkräfte des Rettungsdienstes differenzierten weiter zwischen bewusster und unbewusster Gewalt. Dabei stellten sie auf bestimmte Krankheiten (bspw. Demenz) ab und brachten diesen Personengruppen mehr Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen entgegen. Gewalt wird demnach auch als soziale Erfahrung oder Bedrohung der eigenen Integrität verstanden. Teilweise wurden von den Polizeibeamt:innen bereits Beleidigungen als Form psychischer Gewalt aufgefasst. Im Zuge der Aktenanalyse dominierte jedoch ein rechtliches Gewaltverständnis, welches den Sachberichten und Zeug:innenaussagen, insbesondere der eingesetzten Polizeibeamt:innen entnommen werden konnte. Die Bedrohung wurde als eine weitere Anfeindung und eine Art Qualifizierung von verbaler Gewalt aufgefasst. Der Übergang von verbaler zu körperlicher Gewalt, äußere sich gerade in der Entwicklung sinkender Hemmschwellen auf Seiten der Bürger:innen.
„[…] Spinner gab es früher auch schon. Aber das war dann vereinzelt der Fall. Heute muss man eigentlich immer damit rechnen, dass die Situation eskaliert. Also die […] Hemmschwelle aus einem Wortgefecht […] in eine körperliche […] Gewalt reinzukommen, ist […] deutlich niedriger als vor ein paar Jahren. Würde ich vom Gefühl her sagen.“ (Feuerwehr\20210429_v_fw_a: 21)
Gesamtheitlich betrachtet ist die Arbeitswirklichkeit von Einsatzkräften aus deren Sicht von physischer als auch psychischer Gewaltanwendung geprägt.
Parallel dazu berichteten Einsatzkräfte über respektloses Verhalten von Bürger:innen, das sich etwa durch Behinderungen der Einsatzausübung, Filmen oder das Veröffentlichen von Einsatzgeschehen mit beleidigenden Kommentaren sowie sich in einem herabwürdigenden bis hin zu einem (strafbaren) beleidigenden Verhalten den Polizeibeamt:innen gegenüber – auch wenn diese nicht im Dienst waren – äußerte. Die Begriffe Gewalt und Respekt sind damit nicht zwangsläufig deckungsgleich: Während Respekt eher auf die Anerkennung der institutionellen Rolle, Autorität und sozialen Regeln rekurriert, meint Gewalt einen aktiven Eingriff in die Handlungsfähigkeit oder die Integrität einer Person.
Die Interviewten deuteten teilweise die von Gewalt geprägten Handlungen als Anfeindungen gegen den Staat bzw. das durch ihn repräsentierte Gewaltmonopol und setzen diese Entwicklung in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einer Abnahme des Vertrauens von Bürger:innen gegenüber staatlichen Institutionen.
„Ich persönlich glaube, dass es mit so einem Verdruss dem Staat gegenüber zusammenhängt […] und wir quasi […] den Staat ja repräsentieren und wir so als die […] Verlängerung des Staates da fungieren und dann auch dafür herhalten müssen. Das […] ist so eine Interpretation von mir […].“ (Feuerwehr\20210429_v_fw_a: 11)
Die Ursachen für wahrgenommene Respektlosigkeit wurden von Polizeibeamt:innen u.a. in mangelnder Erziehung, sozialen Verschiebungen und der sprachlichen Verrohung Jugendlicher gesehen. Aus dem Mangel an vermittelten Normen resultiere eine Verschiebung von Werten.
„Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, so wie sie untereinander sprechen, reden sie dann auch mit dem Polizeibeamten, weil sie es nicht anders kennen. (PolizeibeamtInnen\20200909_v_pol: 93-97)
Außerdem ließ sich in der Gesamtschau von Aktenanalyse und problemzentrierten Interviews erkennen, dass die Beschuldigten weitestgehend von negativen Erfahrungen mit Polizeibeamt:innen berichteten, welche sie an der Art und Weise der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen festmachten. Kommunikation und Umgang spielten hier eine zentrale Rolle.
„[W]eil ich das Gefühl habe, das ist […] so eine alte faschistische Tugend gewesen, dass man so aus Prinzip erstmal den Staatsdienern in Uniformen irgendwie respektvoll gegenübertritt. […] Die Uniform alleine ist ja noch kein Grund, Respekt zu haben […]. Sondern […] die Art und Weise, wie sich Leute verhalten und […] welche Rolle diese Institution einnimmt.“ (Bürger:in\1612266834-20201216_pzi_b: 70-71)
Ein aus ihrer Sicht erfolgtes Fehlverhalten wurde auf die gesamte Institution der Polizei projiziert, so dass sich zwei kontroverse Einheiten gegenüberstehen: Während staatliche Organisationen tendenziell davon ausgehen, dass die Uniform oder die institutionelle Rolle automatisch Respekt vermittelt, zeigen die Interviews, dass Respekt in der Interaktion vor allem an das konkrete Verhalten der handelnden Personen und die Art der Durchsetzung von Aufgaben gebunden ist.
Diese Diskrepanz kann ein Hinweis auf ein bestehendes Konflikt- bzw. Eskalationspotenzial sein: Bürger:innen können formale Autorität als nicht automatisch legitim wahrnehmen, während Einsatzkräfte die Nichtbeachtung als Respektlosigkeit oder Angriff auf die eigene Integrität interpretieren. In Kombination mit dem extensiven Gewaltverständnis der Einsatzkräfte zeigt sich ein Spannungsfeld, in dem physische und psychische Gewalt, wahrgenommene Respektlosigkeit und die Interpretation institutioneller Autorität miteinander verknüpft sind.
3. Angewendete Gewaltformen
a) Verfahrensaktenanalyse
Die Auswertung der Gewaltform der Einsatzkräfte hat gezeigt, dass die Androhung von Gewalt mit dem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt einherging. So ging bspw. dem Reizgaseinsatz die Androhung des Einsatzes der Maßnahme voraus. In einem Fall fand eine Gefährderansprache statt. Einfache körperliche Gewalt fand in Form von Schieben, Schubsen, Umrennen, Stoßen, Schlag mit der Faust gegen den Kopf, Fixierung und Fesselung statt. Gewalt unter Einsatz von den Hilfsmitteln Einsatzmehrzweckstock und Reizgas fand in 8 Fällen statt. In 2 Fällen wurde der Schusswaffengebrauch angedroht, in einem weiteren Fall ein Warnschuss abgegeben. Insgesamt zeigt sich auch hier, dass in den meisten Fällen der Einsatz unter der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt bzw. der Androhung dieser verlief. Im Rahmen der Verfahrenseinstellungen unterschied sich das Bild der Gewaltformen kaum.
In den meisten Fällen der Verurteilungen wendeten die Beschuldigten ebenfalls einfache körperliche Gewalt in Form von Schlägen, Tritten, Losreißen, Schubsen, Kratzen, Spucken oder Beißen an. Viele Handlungen spielten sich im Bereich des straflosen passiven Widerstands ab. In den Sachberichten wurden zudem häufig neben den passiven Widerstandshandlungen (bspw. Verschränken der Arme) von typischen sog. Zappelwiderständen (bspw. Strampeln) berichtet. In 7 Fällen wurde mit dem Einsatz von Gewalt gedroht. Auch ein Hochziehen der Arme und mehrfach das Fallenlassen des:der Beschuldigten wurde in den Berichten als Widerstandshandlung aufgeführt. In 3 Fällen kam es zu schweren Verletzungen der Einsatzkräfte. Es kam in keinem Fall zu einem Einsatz einer Schusswaffe gegen die Einsatzkräfte. In einem Fall wurde eine ungeladene Waffe auf die Polizist:innen gerichtet, in einem weiteren wurde versucht, die Dienstwaffe zu entwenden. Ein Fall endete mit einer Stichverletzung, welche der:die Beschuldigte der Einsatzkraft zufügte.
Auffällig war im Rahmen der Verfahrenseinstellungen eine deutliche Steigerung der Fälle (22 %) nach der Gesetzesreform, in denen die Beschuldigten seitens der Einsatzkräfte unter Anwendung einfacher körperlicher Ge-walt zu Boden gebracht wurden, um sie zu fixieren oder im Anschluss zu fesseln. Dabei wurde in den meisten Fällen der unmittelbare Zwang angedroht, in den übrigen war dies situationsbedingt nicht möglich.
Ebenso konnten nach der Gesetzesreform bei der Analyse der Verfahrensakten in den Zeug:innenaussagen, Widerstandsanzeigen, Strafbefehlen und Urteilen, vermehrt das Beisichführen gefährlicher Gegenstände gefunden werden. In 7 Fällen wurde von einem Messer, in einem Fall von einem mitgeführten Schlagring berichtet. Dieser Befund kann auf die Änderung des § 113 Abs. 2 StGB zurückgeführt werden, wonach keine Verwendungsabsicht der Waffe oder des gefährlichen Werkzeuges mehr nötig ist. Ein dem einhergehendes verändertes Anzeigeverhalten der Einsatzkräfte kann einen Grund für die Zunahme darstellen. Danach ist eine Erklärung der zugenommenen Berichterstattung weniger auf eine tatsächliche Zunahme qualifizierter Körperverletzungen zurückzuführen als vielmehr auf die veränderte Rechtslage, wonach das bloße Beisichführen ohne Verwendungsabsicht bereits eine Strafbarkeit begründet.
b) Interviews
Bei der Betrachtung der Qualität der Gewaltformen durch das zivile Gegenüber fiel in den Berichten der Einsatzkräfte auf, dass einfache körperliche Gewalt, teilweise kombiniert mit straflosen Verhaltensweisen als häufigste Form benannt wurde. Vermehrt berichteten hiervon Einsatzkräfte der Polizei und aus dem Not-/Rettungsdienst. Hierzu zählten oftmals Handlungen, wie das Spucken, Beißen, Treten und Schlagen sowie das Sperren des Körpers bei Vollstreckungshandlungen wie der Festnahme bzw. im Zuge der Abwehrhandlung gegen eine Fixierung. Interviewte berichteten vereinzelt auch von sexualisierten Handlungen:
„Ähm ja, und dann fing es an, als wir ihn umlagern wollten und er die Handschellen ab hatte, hat er mir zwischen die Beine gegriffen und er hat auch nicht mehr losgelassen bis der Polizist sich dann auf seinen Arm gestützt hat und den Arm weggerissen hat.“ (20210426_v_fw_b: 99)
Des Weiteren berichteten Einsatzkräfte aus dem Not-/Rettungsdienst und der Polizei (jeweils 5 Fälle) Drohungen mit Gewalt, vermehrt im Rahmen der Fixierung oder Festnahme. Vereinzelt wiesen Drohungen nonverbale Elemente auf (2 Fälle), etwa das Emporstrecken von Fäusten oder das Zubewegen mit einer erhobenen Bierflasche auf die Einsatzkräfte. Die Interviewempirie ergab auch, dass Gewaltausübung unter Einsatz von Hilfsmitteln stattfindet, welche sich auf eine vielfältige Weise äußerte. Innerhalb der Perspektive der Feuerwehr verwendeten die Bürger:innen eine Tür und eine Pumpgun. Bürger:innen, die sich im Rahmen polizeilicher Einsätze Hilfsmittel bedienten, verwendeten am häufigsten Flaschen (4 Fälle), gefolgt von Einzelfällen mit einem großen Spiegel, Küchenmessern, einem Fahrrad und einem Hund.
Von Fällen, in denen Einsatzkräfte der Feuerwehr und dem Not-/Rettungsdienst selbst Gewalt ausübten, wurde kaum berichtet. Im Zuge der Einsätze konnte jeweils lediglich ein Fall einfacher körperlicher Gewalt in Form der Fixierung festgemacht werden. Innerhalb dieser Stufe konnten Schläge im Rahmen von Abwehrhandlungen durch den Not-/Rettungsdienst als eine weitere Gewaltanwendung bestimmt werden. Deutlich häufiger wurde Gewalt durch Einsatzkräfte der Polizei angewendet. In der Mehrheit ging es im Zuge der einfachen körperlichen Gewalt um das Fixieren der:des Beschuldigten in Situationen, in denen Gefahr zur Eskalation bestand. Auch wurde von Handlungen, wie Schlägen und Tritten berichtet, die sowohl im Zuge von Interaktionsdynamiken und als Reaktion auf einfache körperliche Gewalt als auch vereinzelt als Abwehrhandlungen folgten. Am häufigsten verwendeten Polizeibeamt:innen als Hilfsmittel das Reizstoffsprühgerät (9 Fälle) sowie die Schusswaffe (3 Fälle). Von einem Einsatz von Tasern und einem Einsatzmehrzweckstock wurde jeweils nur in einem Einzelfall berichtet.
Aus 4 der 10 Interviews ging hervor, dass der:die Bürger:in körperlich gegen eine:n Polizeibeamt:in vorging oder ihm:ihr ein solches Verhalten vorgeworfen wurde. Mehrheitlich (3 Fälle) handelte es sich bei der Tathandlung um Schläge. In 2 Fällen stellten sich die Schläge als Abwehrhandlung gegen eine Fixierung bzw. das Zu-Boden-Werfen durch die Polizei dar.
Die Interviewempirie verdeutlicht, dass einfache körperliche Gewalt die höchste Relevanz aufweist und einen interaktiven Charakter besitzt.
c) Verletzungsfolgen
Meistens blieben auf beiden Seiten schwerwiegenden physischen Verletzungsfolgen aus. Die am häufigsten dokumentierten Verletzungen waren Hautabschürfungen, Kratzer, Prellungen, Hämatome und kleine Blutungen. In Einzelfällen – ausschließlich im Hinblick auf Polizeibeamt:innen – traten schwerere Verletzungen auf, wie Prellungen, Fehlstellungen, Brüchen, Sehnen- bzw. Bänderrissen, sowie einer Nervdurchtrennung, deren Folge eine Dienstunfähigkeit war. Auf Seiten der Beschuldigten kam es in einem Fall zu einer schwereren Folge durch einen Hundebiss.
Auffällig war, dass die Verfahrensakten ausführliche Dokumentationen kleinster Kratzer und Prellungen der Einsatzkräfte enthielten. In deutlich weniger Fällen fand eine derart detaillierte Dokumentation für Verletzungen auf Seiten der Beschuldigten statt. Es bleibt insofern offen, ob in den übrigen Fällen eine Dokumentation der Verletzungen der Beschuldigten unterblieb oder ob es keine Verletzungen gab.
Psychische Nachwirkungen wurden nur im Rahmen der PZI berichtet, und zwar häufiger von polizeilichen Einsatzkräften. Während sich jeweils lediglich ein Fall aus dem Lager der Feuerwehr sowie aus dem Lager des Not-/Rettungsdienstes in einem Gefühl von Unwohlsein und Schreckhaftigkeit äußerte, gehörten Ängste, die sich beispielsweise in Flashbacks manifestierten, zu den psychischen Folgen, welche Einsatzkräfte der Polizei bewältigen müssen. In einem Fall führte die konkrete Situation zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bürger:innen berichteten in zwei Fällen von psychischen Folgen in Form von Traumatisierungen bei sich selbst bzw. Personen, die im Rahmen der geschilderten Interaktion ebenfalls anwesend waren, wobei sich diese davongetragenen Traumata vielmehr auf die Situation im Ganzen, als auf eine konkrete Situation innerhalb der Interaktion selbst bezogen. A
4. Eskalationen im Zusammenhang mit Alkohol, Betäubungsmitteln und psychischen Erkrankungen
Als Haupteskalationsfaktor konnte im Rahmen von GeVoRe der Alkoholeinfluss der Bürger:innen identifiziert werden. Bei den Verurteilungen wie bei den Verfahrenseinstellungen waren über 50 % der Beschuldigten zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Dass der Konsum von Alkohol gewaltfördernde Effekte aufweist, stellt keinen überraschenden Befund dar und wurde bereits in der Literatur beschrieben.[86] Auch das Vorliegen von psychischen Erkrankungen bzw. Auffälligkeiten spielte in den Daten eine herausragende Rolle, sowohl durch gesicherte Diagnosen als auch durch eigene Angaben oder Vermutungen einer psychischen Störung. Überwiegend waren sie bei Beschuldigten aus den Verfahrenseinstellungen protokolliert (28 % vor und 44 % nach der Reform). Davon stand bereits jede:jeder Dritte unter Betreuung. Angaben zum Konsum von Betäubungsmitteln fanden sich in der Gesamtbetrachtung indes deutlich weniger (7 % vor und 12 % nach der Gesetzesreform). Interessant erweisen sich die Erkenntnisse zum Zusammenhang mit der Schwere des Delikts. Hier zeigt sich im Rahmen der Aktenanalyse, dass unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Substanzen keine schweren Delikte verwirklicht wurden. Auch in den Fällen eines tätlichen Angriffes (§ 114 StGB) wurde weit überwiegend eine einfache Körperverletzung (§ 223 Abs. 1 StGB) oder gar keine Körperverletzungsdelikte mitverwirklicht. In nur 22 % der Fälle ging eine qualifizierte Körperverletzung mit dem Widerstandsdelikt einher.
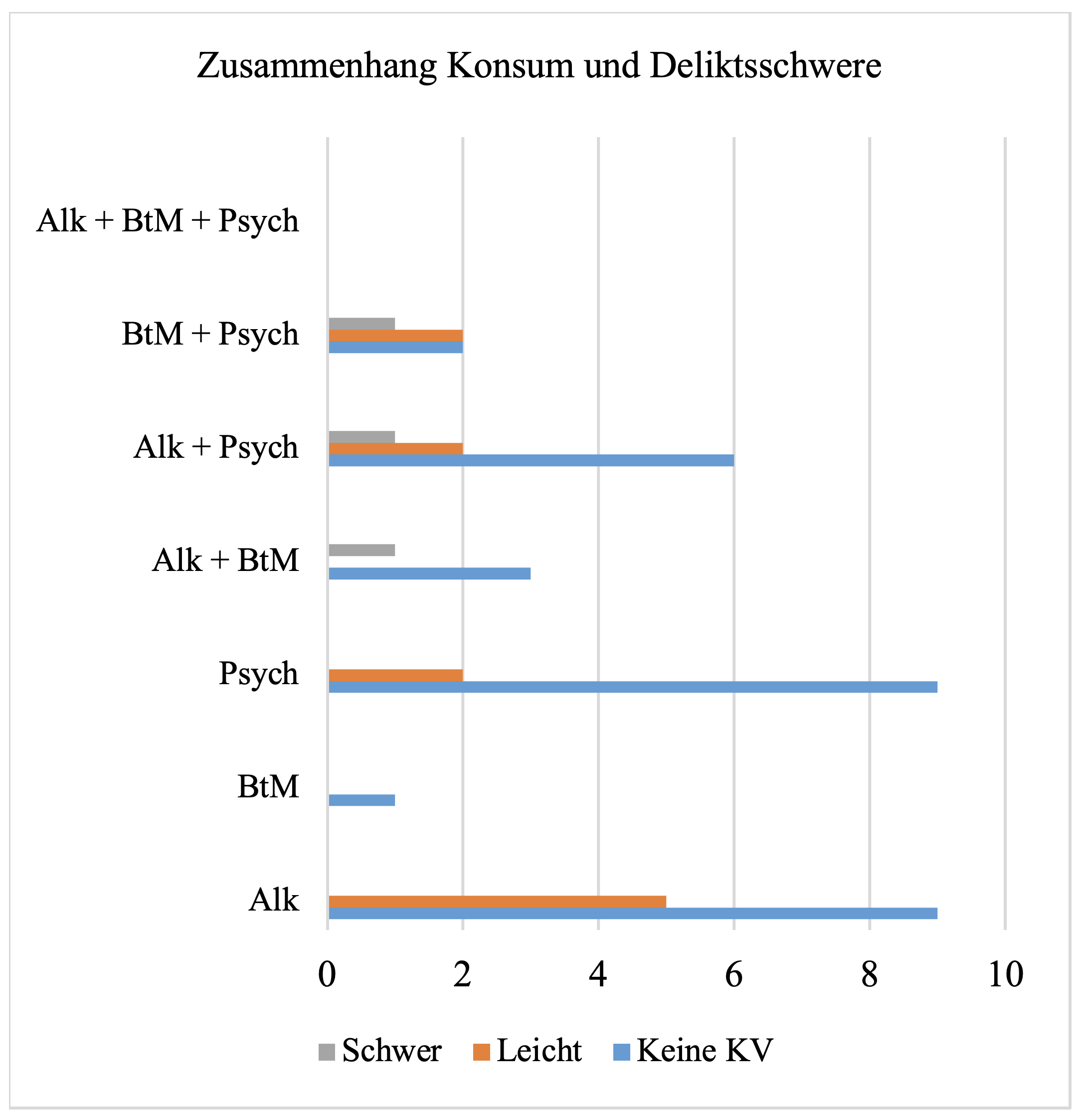
Abbildung 1: Fallzahlen, Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und/oder Drogenkonsum und/oder psychische Erkrankungen und der Schwere des Delikts im Rahmen der Verurteilungen.
Im Hinblick auf die Verfahrenseinstellungen eignet sich ein Blick auf den Zusammenhang zwischen Konsum/Er-krankung und der Deliktsschwere nur bedingt, da bei den Einstellungsentscheidungen der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte letztlich auch der verursachte Schaden eine Rolle spielt. In 25 % der Fälle wurde trotz des Vorliegens einer leichten Körperverletzung das Verfahren eingestellt. Dabei standen die Körperverletzungsdelikte in über der Hälfte der Fälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, bei den übrigen Taten kam eine psychische Erkrankung hinzu. Eine Kombination aus Alkohol-, Betäubungsmittelkonsum und psychischer Erkrankung nahm auch im Rahmen der Verfahrenseinstellungen insgesamt keinen größeren Einfluss auf die Schwere des Deliktes.
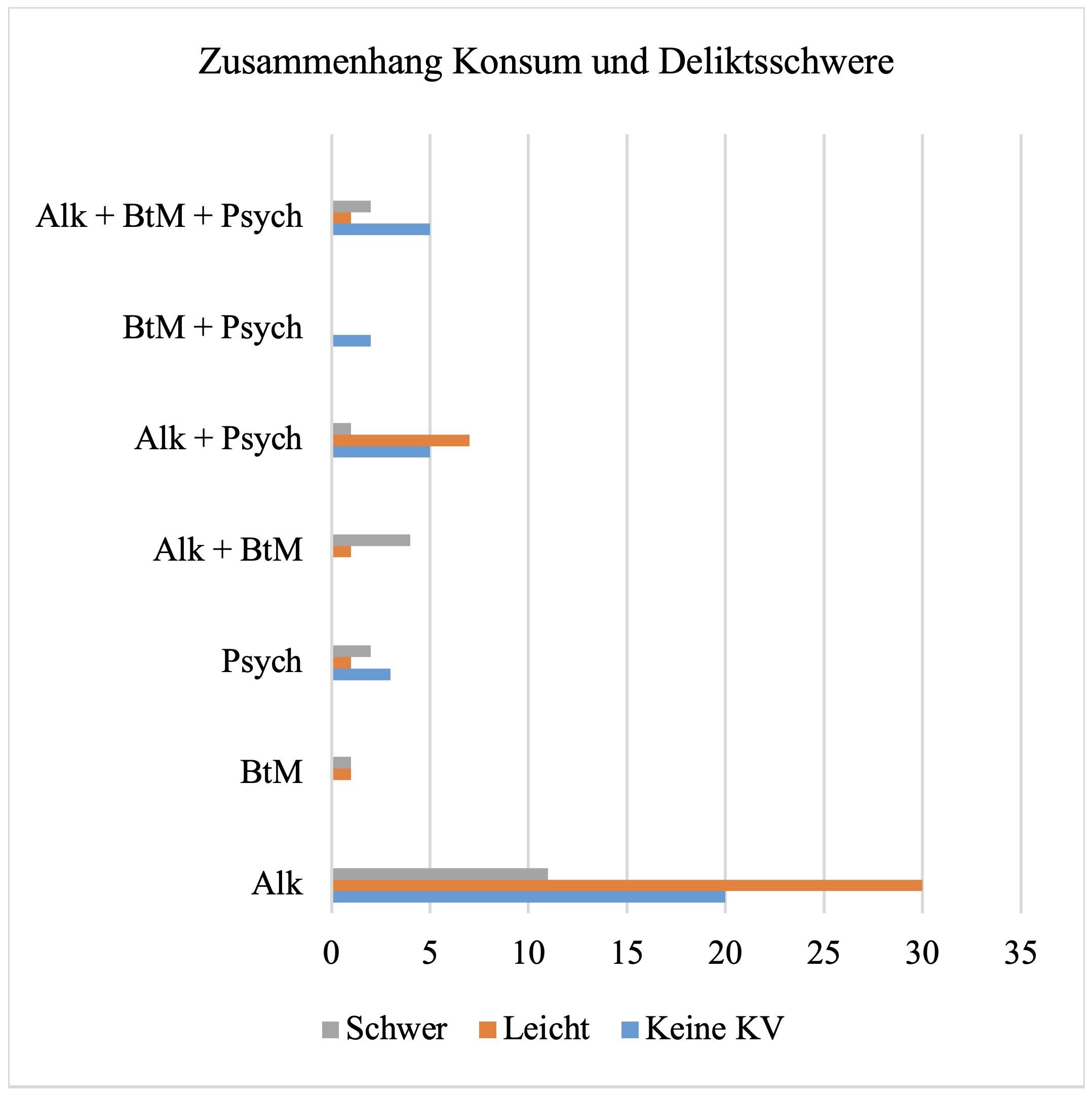
Abbildung 2: Fallzahlen, Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und/oder Drogenkonsum und/oder psychische Erkrankungen und der Schwere des Delikts im Rahmen der Verfahrenseinstellungen.
Ein Zusammenhang zwischen Komorbidität und Schwere des Deliktes liegt nach Auswertung aller Verfahrensakten demnach nicht vor. Betrachtet man den im Interaktionsprozess vorgelagerten Zeitpunkt, den Beginn der Begehung der Straftat, in Abhängigkeit zum Konsum/Erkrankung der beschuldigten Person, zeigt sich ein anderes Bild. Alkohol, BtM-Konsum und Vorliegen einer psychischen Erkrankung stellen in allen untersuchten Fällen den Haupteskalationsfaktor dar. Gewaltfördernde Effekte von Alkoholkonsum, wie z.B. Görgen und Nowak zusammenfassend darstellen,[87] lassen sich durch die Analyse in GeVoRe bestätigen.
5. Eskalationsverlauf
Neben situativen und persönlichen Merkmalen der Konfliktparteien, stand die Betrachtung des Eskalationsverlaufs im Zentrum der Analyse der Interaktionsdynamiken. Die Kommunikation wurde sowohl im Hinblick auf verbale als auch auf nonverbale Sprachelemente untersucht. Der verbale Dialog kennzeichnete sich dadurch, auf welche Art und Weise kommuniziert wurde. Im Zuge der nonverbalen Kommunikationsform hingegen standen vielmehr Gestik und Mimik im Vordergrund der Analyse.
Der kommunikative Ablauf der Interaktion war aus den Verfahrensakten nur bedingt ersichtlich. Zum einen ließ sich aus den Sachberichten, welche sich auf strafrechtlich relevante Fakten beschränken, eine abseits von Maßnahmen stattgefundene Interaktion, kaum erschließen. Situative Rahmenbedingungen der Kommunikation wie Ton und Lautstärke wurden dabei größtenteils nicht erfasst. Zum anderen waren in den meisten Akten insbesondere die Zeug:innenaussagen der eingesetzten Beamt:innen enthalten, wodurch die Sichtweise der Beschuldigten nur unzureichend abgebildet wurde. Den Strafverfahrensakten ließ sich jedoch der Inhalt der Kommunikation entnehmen. Besonders ersichtlich wurde beispielsweise, ob Aufforderungen und Androhungen durch die Einsatzkräfte stattfanden und welche Äußerungen die Beschuldigten gegenüber den Einsatzkräften tätigten. Dabei ergaben sich keine Unterschiede bei einer Betrachtung der Fälle vor und nach der Reform der Widerstandsdelikte. So ließen sich in den ausgewerteten Verfahrensakten insgesamt drei verschiedene Kommunikationsabläufe erkennen. In die erste Gruppe sind die Fälle einzuordnen, in denen der:die Beschuldigte plötzlich aggressiv reagierte. Der:Die Beschuldigte unterlag dabei häufig einem Überraschungsmoment z.B. durch Wecken des:der Schlafenden, so dass die Situation sich explosionsartig zuspitzte. Die Kommunikation seitens der Einsatzkräfte war zwar hierbei häufig von einer nach eigenen Angaben ruhigen, sachlichen Ansprache gekennzeichnet, sie konnten aber nicht immer zu den Beschuldigten durchdringen. Meist korrelierten diese Einsätze mit einem Alkoholkonsum.
In der zweiten Gruppe ließ sich seitens der Einsatzkräfte eine verhältnismäßige Steigerung der eingesetzten Mittel beobachten. Die Einsatzkräfte forderten den Beschuldigten zunächst auf, eine Handlung zu unterlassen oder einer Aufforderung nachzukommen. Auf die zunächst sachlichen Aufforderungen reagierte der:die Beschuldigte nicht oder widersetzte sich demonstrativ den Anweisungen und es kam zur Provokation oder zu Beleidigungen durch den:die Beschuldigten. Außerdem wurden in den Sachberichten der Einsatzkräfte Solidarisierungseffekte weiterer zunächst unbeteiligter Personen beschrieben, die den Gebrauch kommunikativer Mittel erschwerten, weil sie dazwischenredeten oder versuchten, die Beschuldigten loszureißen. Nicht selten kam es in diesen Fällen auch zu einem Filmen der Einsatzkräfte oder zu einem Anzweifeln der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung. Derin und Singelnstein verweisen darauf, dass eine einmal begonnene Maßnahme durch die handelnden Einsatzkräfte konsequent durchgezogen und ein Rückgang zu gewaltfreier Kommunikation als nicht mehr möglich erachtet werde.[88] In den meisten Fällen wurde aus den Zeug:innenenaussagen der Einsatzkräfte ein derartiger kommunikativer Interaktionsablauf jedoch sichtbar. Fälle, in denen nach eingeleiteter Maßnahme auf eine kommunikative Strategie zurückgegriffen wurde, erwiesen sich als deeskalierend im Hinblick auf das weitere Interaktionsgeschehen. Im Rahmen der Verfahrenseinstellungen kam es sogar in zwei Fällen zu einem Abbruch der Maßnahme, um die Situation zu deeskalieren. Innerhalb der zweiten Gruppe fielen außerdem insbesondere bei den Verfahrenseinstellungen die Kontakte mit (teilweise suizidgefährdeten) psychisch Erkrankten auf. Auch hier reagierten die Beschuldigten auf eine erste Ansprache unvermittelt aggressiv, schlugen um sich und beleidigten die Einsatzkräfte. Teilweise war eine Kommunikation im weiteren Verlauf des Geschehens nicht mehr möglich, weil die Beschuldigten in eine Starre verfielen, Selbstgespräche führten oder impulsiv reagierten. Infolgedessen drohten die Einsatzkräfte auch hier in den meisten Fällen den Einsatz unmittelbaren Zwangs an, in zwei Fällen ließen die Umstände eine Androhung aufgrund des unvermittelten Handelns des:der Beschuldigten jedoch nicht mehr zu. Zudem kam es bei den Verfahrenseinstellungen in vier Fällen aufgrund einer Sprachbarriere zu Auseinandersetzungen, da eine Kommunikation nur bedingt möglich war. Dadurch kam es mitunter zu Fehlinterpretationen des Verhaltens der Beschuldigten. Eine Sonderkonstellation innerhalb der zweiten Gruppe bildeten die Fälle des Suicide by Cop. Unter den Verfahrenseinstellungen fanden sich hierzu zwei Fälle, in denen nach einer ersten ruhigen Ansprache der Einsatzkräfte die Aufforderung der Beschuldigten, sie zu erschießen, folgte. Aufgrund der Kenntnis der suizidalen Absichten und der akuten Selbstgefährdung wurde seitens der Einsatzkräfte sofort unmittelbarer Zwang angewendet.
Die dritte Gruppe kennzeichnete eine geringe Anwendung kommunikativer Mittel seitens der Einsatzkräfte. Der:Die Beschuldigte zeigte von Beginn des Einsatzes an ein hochaggressives Verhalten, schrie, beleidigte, bedrohte oder bespuckte die Einsatzkräfte. Darunter sind auch Situationen zu fassen, bei denen es innerhalb eines Demonstrationsgeschehens unmittelbar zu einem Angriff ohne weitere Kommunikation seitens der Beschuldigten kam. Belehrungen wurden hier als teilweise nicht möglich beschrieben. Häufig wurde unmittelbarer Zwang ohne vorherige Androhung eingesetzt. Bei den Beschuldigten dieser Gruppe wurde zudem oft ein Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum zum Tatzeitpunkt festgestellt. Von Solidarisierungseffekten (Bsp.: Ziehen an Schutzwesten der Polizist:innen durch eine Menschentraube) wurde hier ebenfalls berichtet. Dieser zusätzliche Umstand erschwere den Einsatz kommunikativer Mittel durch die Einsatzkräfte.
Die befragten Einsatzkräfte beschrieben diese Kommunikationsabläufe im Rahmen der PZI ebenfalls. Neben dem Inhalt konnten jedoch auch Erkenntnisse zur Tonalität, Lautstärke sowie zur nonverbalen Form der Kommunikation gewonnen werden. Im Zuge der ersten Gruppe beschrieben die Interviewten die Ansprache mehrheitlich als ruhig und sachlich. Kontextbezogen ließ sich auch eine formale Ausdrucksweise, beispielsweise im Zuge von polizeilichen Verkehrskontrollen feststellen. Jedoch zeigte sich auch eine informelle Ausdrucksweise durch die Einsatzkräfte der Polizei in solchen Fällen, in denen das polizeiliche Gegenüber friedlich, aber betrunken war.
„Also da es ein betrunkener Mensch war, kann man relativ […] laissez-faire damit umgehen. Da steigt man einfach aus, sagt relativ laut: Ey, was ist los? Hast du ein Problem? [J]etzt aber nicht in diesem Sinne von: hast du ein Problem, Alter?, Sondern einfach nur: Gibt es ein Problem? Und dann auch […]: Was ist denn los? Kann ich helfen? Zu viel getrunken heute? Alles in Ordnung? Das waren so die ersten […] Fragen, damit es erstmal, ich sage mal, in ein Gespräch überhaupt kommt, um Informationen zu gewinnen.“ (20200706_v_pol_a: 91)
Als Reaktion des polizeilichen Gegenübers folgte oftmals ein Erfragen des Grundes, und zwar auf eine als aggressiv, provozierend und teilweise feindselig sowie beleidigend wahrgenommene Art und Weise. Teilweise wurde von verbalen Aufschaukelungsprozessen berichtet. Eine verhältnismäßige Steigerung der eingesetzten Mittel seitens der Einsatzkräfte der Polizei wurde inhaltlich vor allem innerhalb der tatbezogenen Kommunikation und der Aufforderung, Weisungen nachzukommen oder Handlungen zu unterlassen, vorgenommen. Die Kommunikation innerhalb der zweiten Gruppe war in aller Regel von einer sachlichen Ansprache und einem ruhigen Tonfall geprägt. Gerade auf Letzteres wurde seitens des polizeilichen Gegenübers mit Ignoranz reagiert. Auf die sachliche Androhung von unmittelbarem Zwang durch Einsatzkräfte der Polizei folgten ausnahmslos Beleidigungen durch die Bürger:innen, teilweise gefolgt von Bedrohungen. Auch fanden Beleidigungen im Rahmen dieser Einsätze teilweise in einem sehr frühen Stadium durch Dritte statt, und zwar im Zusammenhang mit vorübergehenden Blockaden des Einsatzfahrzeugs. Während der Interaktion erfolgte die Kommunikation durch das Gegenüber lautstark durch Brüllen und Anschreien. Als Reaktion darauf erfolgte die Ansprache seitens der Polizei zum einen laut, um Dominanz auszudrücken.
„Und wir haben recht laut gesprochen. Gleich um […] quasi mit der Stimme schon eine gewisse Dominanz auszudrücken. [D]as ist so das erste Mittel. [D]ass er merkt: Oh, jetzt ist hier jemand, der sagt, in Anführungsstrichen, wo es langgeht.“ (20200706_v_pol_a: 87)
Zum anderen wurde Kommunikation seitens der Einsatzkräfte aller Lager positiv geschildert und bewusst auf Augenhöhe geführt und so eingesetzt, dass sie auf das polizeiliche Gegenüber eine beruhigende Wirkung entfaltete. Dies stellte sich gerade im Umgang mit alkoholisierten Personen als deeskalierender Faktor heraus.
Im Rahmen der Bürger:inneninterviews zeichneten sich lediglich zwei der drei bereits beschriebenen Kommunikationsabläufe ab. Unter die zweite Gruppe sind Fälle einzuordnen, die sich auf das Erfragen des Einsatzgrundes beziehen. Die Fehldeutung der Situation bzw. das Unverständnis seitens der Bürger:innen schien hierbei Anlass zu sein. Die Tonalität erwies sich sowohl als sachlich und ruhig als auch teilweise provozierend und spiegelte sich in einer erhöhten Lautstärke wider, welche aus gruppendynamischen Prozessen resultierte.
Innerhalb der dritten Gruppe der Kommunikationsabläufe schilderten die Befragten aus ihrer Sicht Maßnahmen seitens der Einsatzkräfte, die nicht angekündigt wurden und entsprechendes Verhalten, wie ein zügiges Zubewegen, zunächst nicht gedeutet werden konnte. Gerade durch die darauffolgende direkte Anwendung körperlicher Gewalt unter Anwendung von Hilfsmitteln durch Polizeibeamt:innen wurde dieses Vorgehen als illegitim wahrgenommen.
„[Die haben sich in einer] Reihe auf uns zu bewegt. Sehr, sehr zügig. Ich kenne das eigentlich so, dass die dann vorher nochmal stehenbleiben und sagen: so. Jetzt verlassen Sie bitte den Bereich. Machen Sie den Weg frei. Gehen Sie weg. […] Das haben sie nicht gemacht. […] Deswegen ist mir diese Situation auch so besonders in Erinnerung geblieben. […] Was ich nochmal von anderen Situationen, die ich mit der Polizei erlebt habe, unterscheide. Die sind einfach zügig und direkt auf [uns] zugestürmt und haben halt direkt angefangen Schlagstöcke einzusetzen. Aber auch Faustschläge. Und Tritte.“ (Bürger:in\1620380692-21200424_pzi_b: 212-217)
6. Gründe für Wende- und Eskalationspunkte
Weiteren Gegenstand der Analyse bildete die Frage nach den Gründen von Wende- und Eskalationspunkten innerhalb der jeweiligen Interaktion. Neben einzelnen eskalativen Handlungen, wurden Aspekte der Gruppendynamik herangezogen, die möglicherweise zu Solidarisierungseffekten beitragen können. Daneben wurden auch explizit Maßnahmen der Deeskalation analysiert, um festzustellen, inwieweit diese Wendepunkte einer Interaktion darstellen können.
a) Verfahrensaktenanalyse
Eskalationspunkte zeigten sich in der Verfahrensaktenanalyse vor allem, wenn der:die Beschuldigte zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, Betäubungsmittel konsumiert hatte, psychische Auffälligkeiten bis hin zu Erkrankungen aufwies oder eine Kombination der genannten Faktoren vorlag. Es kam in diesen Situationen häufig zu schlagartigen Schwankungen und unvorhersehbarer körperlicher Gewalt durch den:die Beschuldigte:n. Auch gruppendynamische Prozesse und (teilweise damit einhergehende) Solidarisierungseffekte wurden durch die Einsatzkräfte als Aspekte in ihren Sachberichten und Zeug:innenaussagen genannt, die zur Eskalation der Situation beitrugen. Aufschaukelungsprozesse sowohl im Verhältnis Bürger:in/Bürger:in als auch zwischen Bürger:in und Einsatzkraft kennzeichneten derartige Interaktionen. Ein weiterer wesentlicher eskalativer Faktor war das Eindringen in die Intimsphäre, sowohl körperlicher Art (Bsp.: Berühren der beschuldigten Person) als auch ein Eindringen in den geschützten Wohnbereich (Bsp.: Fälle häuslicher Gewalt). Zur Eskalation selbst kam es in den meisten Fällen bei der Durchsetzung der konkreten Maßnahme.
Typischerweise kam es nach Überschreitung des Eskalationspunktes zum Einsatz unmittelbaren Zwangs nach oder ohne Androhung durch die Einsatzkräfte. Es gab aber auch Fälle, in denen die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang androhten, es aber nicht zum Einsatz körperlicher Gewalt kam, sondern der Einsatz mittels gewaltfreier Kommunikation beendet werden konnte oder die Maßnahme zu deeskalierenden Zwecken ganz abgebrochen wurde.
b) Interviews
Der Eskalationspunkt wurde im Rahmen der PZI von den Polizeibeamt:innen typischerweise als Situation beschrieben, in der der:die Beschuldigte körperlich auf den:die Polizeibeamt:in einwirkten und sodann die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich wurde. Ähnlich zu den Ergebnissen aus den Verfahrensakten, ordnete auch die Mehrheit der Einsatzkräfte den Konsum von Alkohol oder Drogen als häufigsten Eskalationsfaktor ein. Aber auch psychische Erkrankungen oder emotionale Ausnahme- bzw. Belastungssituationen (Bsp.: Trennung) seien der Grund für ein höheres Eskalationsrisiko.
„Ich glaube schon, dass der Schwerpunkt der ganzen Situation sich daraus ergibt, dass man […] in einer besonders psychischen Situation ist, man aufgelöst ist, aus was für Gründen auch immer, Alkohol, Drogen, Beziehungssituation. Man muss vielleicht ins Gefängnis oder irgendwas. Und die Sachen sich dann daraus ergeben.“ (20200909_v_pol: 145)
Ebenso sorge ein Eindringen in den persönlichen Bereich des polizeilichen Gegenübers für eine erhöhte Eskalationsgefahr. Darüber hinaus gaben einige Polizeibeamt:innen an, dass auch zuvor gesammelte negative Erfahrungen mit der Polizei dazu beitragen können, dass eine erhöhte Skepsis gegenüber polizeilichen Maßnahmen bzw. der Polizei als Institution bestehe und aufgrund dessen allgemein ein höheres Eskalationsrisiko gegeben sei. Ein konkreter Eskalationsfaktor, welcher individuell ihrem Verhalten oder der Situation anhafte, konnte nicht feststellt werden. Vielmehr seien die Situationen bereits beim Eintreffen der Polizei eskaliert.
Einige Polizeibeamt:innen gaben an, dass auch physiologische Aspekte (Bsp.: Geschlecht, Körpergröße) einen großen Beitrag zu dem Verlauf einer Situation leisten. Sie könnten unter anderem dazu beitragen, dass ein Geschehen über mehr Eskalationspotential verfüge oder aber die Anwesenheit eines:einer Polizeibeamt:in deeskalierend wirke.
„Ein anderer Aspekt ist natürlich, aber das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Kollegen, die kleiner sind, also für männliche Kollegen, die klein gewachsen sind. Ist leider so, ist ein psychologischer Aspekt, da wird eher, denke ich mal, vom Gegenüber gesagt so, okay, bei dem könnte ich es mir ja erlauben. Entweder es ist eine Frau oder ist ein kleiner Kollege. Den schaffe ich vielleicht. Und dann werden die Leute aufmüpfiger.“ (20200818_v_pol_c-3: 8)
„Und deswegen hat er gleich gesehen: okay, jetzt steigen da zwei Kerle aus. Die sehen mir jetzt nicht so nett aus. Die reden zwar nett, aber die wirken nicht nett. Auch wie man das rüberbringt. Das sah wohl, also ich schätze jetzt mal er wusste ganz genau, wenn er jetzt Gewalt anwendet, kommt Gewalt zurück. Das war, glaube ich, so das, was er in diesem Augenblick wahrgenommen hat, wo er sagt: okay, jetzt lasse ich lieber hier mal ein bisschen Ruhe einkehren.“ (20200706_v_pol_a: 115)
Generell wurde auch von gruppendynamischen Prozessen als auch von Sprachbarrieren als Eskalationsfaktoren berichtet.
Von den befragten Bürger:innen wurde der Eskalationspunkt mit der körperlichen Einwirkung, also der Anwendung von unmittelbarem Zwang gleichgesetzt. Überein-stimmungen zu den Interviews mit den Einsatzkräften ergaben sich dahingehend, dass gruppendynamische Prozesse von großer Bedeutung für den Ablauf eines Einsatzes sind. Gerade in Fällen, in denen ein Unverständnis gegenüber der polizeilichen Maßnahme bestand, baute sich ein Spannungsverhältnis auf. Auch das (wahrgenommene) Eindringen in den persönlichen Bereich (räumlich und körperlich) stellte für die Bürger:innen einen Eskalationsfaktor dar.[89] Des Weiteren wurde vorgetragen, dass das nicht transparente Vorgehen der Polizei einen wichtigen Eskalationsfaktor darstelle.
„Und dass die Polizei nicht transparent gearbeitet hat. Also ich glaube, wären die angekommen und hätten gesagt, vor allen Dingen in dem Wissen, wo sie jetzt gerade diese Maßnahme da durchführen wollen, nämlich direkt neben dem Pulk von ihnen sehr skeptisch gegenüberstehenden Leuten, da kann auch einer der Beamten hingehen und sagen: Ey, das ist eine Mordermittlung. Das einzige Anzeichen was wir bekommen haben ist, dass der Täter schwarz ist. Das ist halt scheiße, aber das ist halt irgendwie der einzige Weg, dass wir jemanden finden.“ (Bürger:in\20201216_pzi_b: 351)
Generell wurde der Kommunikation eine entscheidende Rolle zugesprochen. Wichtig war den Bürger:innen dabei eine Kommunikation auf Augenhöhe, die zudem deeskalierend wirke.
„Ja, ich glaube, das wäre total deeskalierend. Also allein, dass man wenn man jetzt weiß, da ist ein Konfliktpotential und man geht da halt kommunikativ rein und nicht abblockend und ihr wollt was Schlimmes von mir, natürlich läuft das anders.“ (Bürger:in\1612266834-20201216_pzi_b: 355)
7. Legitimation des eigenen Verhaltens
Angaben hinsichtlich der eigenen Legitimation ihrer Handlungen, machten die Polizeibeamt:innen in den Interviews nicht. Größtenteils schilderten sie lediglich die von den Bürger:innen angegebenen Hintergründe der Tat. Die Auswertung der Verfahrensakten hat gezeigt, dass Einsatzkräfte vor allem zur Legitimationsstrategie der Berufung auf höhere Instanzen[90] griffen, wonach nicht der eigene Wille maßgeblich für die Handlung ist (hier: Anwendung von unmittelbarem Zwang), sondern im Interesse einer höherstehenden Instanz gehandelt wird (hier: staatliche Gefahrenabwehr).
Bei den Beschuldigten ließen sich in der Gesamtbetrachtung differenzierte Legitimationsstrategien erkennen. Vor dem Hintergrund des Konsums berauschender Substanzen ist zunächst festzustellen, dass eine nachträgliche Rekonstruktion des eigenen Handelns wegen fehlender Erinnerungen nicht möglich war. Teilweise beschreiben sie ihre Handlungen als Notwehr. Eine weitere Rolle spielen affektive Überreaktionen durch Gefühle von Angst bzw. Überforderung.
„Und das war halt eine Situation, wo ich dann einfach letztlich einfach wahnsinnige Angst hatte und mich bedroht gefühlt habe. […] Und mich eben auch angegriffen gefühlt habe, körperlich. Und es dann eben auch zu Widerstandshandlungen gekommen ist. Und halt, ja, reflexartigem sich selbst schützen und dann auch wehren. [I]ch hab jetzt gar nicht […] gedacht, ich wende jetzt mal Gewalt gegen die Polizistinnen an. Sondern das war einfach total reflexartig in dieser Dynamik.“ (Bürger:in\1620380692-21200424_pzi_b: 87)
Reuevoll zeigten sich die Beschuldigten mehrheitlich im Rahmen der Verfahrensaktenanalyse. So kam es häufig zu Entschuldigungen während des Ermittlungsverfahrens oder in der Hauptverhandlung.
V. Die Gesetzesänderung im Diskurs mit den Expert:innen
Mit Expert:innen aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafverteidigung und Richterschaft wurden schwerpunktmäßig Interviews über die Entwicklungstendenzen, Notwendigkeit und Ziele des Gesetzes sowie die Deliktsbearbeitung aus praktischer Sicht geführt.
1. Wahrnehmung der gesellschaftlichen Entwicklung hinsichtlich des Respekts und der Gewaltbereitschaft
Nahezu ausnahmslos nahmen sowohl Expert:innen der Polizei, Staatsanwaltschaft und Richterschaft eine steigende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamt:innen oder staatlichen Institutionen wahr. Dabei lässt sich ein tendenziell niedrigschwellig und stark institutionszentriertes Respektverständnis identifizieren, das primär an formale Anerkennung staatlicher Autorität geknüpft wird. In der Folge wurden hierbei Handlungen, wie das Hinterfragen von Maßnahmen, bereits als respektlos eingeordnet.
Bei der Befragung der Strafverteidiger:innen kam es hingegen zu keiner einheitlichen Meinungsbildung. Die Ansichten divergierten teilweise stark im Hinblick auf die Beurteilung einer steigenden Respektlosigkeit sowie deren Ursachen. Ein Teil der Strafverteidiger:innen äußerte sich dahingehend, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht als fehlender Respekt einzustufen seien. Als Begründung hierfür wurde auf den Ausnahmecharakter von Widerstandssituationen abgestellt. Vor diesem Hintergrund stellten einige Expert:innen in Frage, inwiefern bei Ausnahmesituationen, in denen sich die Täter:innen keine großartigen Gedanken über ihr Handeln machen, überhaupt von mangelndem Respekt die Rede sein könne. Als mögliche Ursachen dieser Entwicklung wurden beispielhaft die Erziehung oder aber die Herkunft einer Person heranzogen. Nach Ansicht eine:r anderen Expert:in würden skandalöse Ereignisse aus den Reihen der Polizei dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Polizei sinke.
Andere Strafverteidiger:innen wiederum deuteten die den Täter:innen vorgeworfene Respektlosigkeit als Kritik an der Maßnahme und sahen in einer kritischen Äußerung in Bezug auf polizeiliches Verhalten vielmehr einen demokratischen Fortschritt als mangelnden Respekt. Es gehöre zu einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass ein staatliches Organ, das Gewalt anwenden dürfe, auch besonders intensiv überprüft werden müsse. Vereinzelt konstatierten Expert:innen in diesem Zusammenhang auch, dass es sowohl den Bürger:innen als auch der Polizei an einem respektvollen Umgang miteinander mangele.
„Würde ich bejahen, weil ich glaube, dass das Gesetz tatsächlich den Gegensatz zwischen Polizei und Bürger verschärft. [Es] stellt die Polizei noch einmal anders dar oder fordert […] mehr Respekt zu haben, die Autorität der Polizei anzuerkennen und so weiter […]. Und ich glaube schon, dass es etwas macht, also ich glaube eher, dass es Feindbilder verstärkt, so würde ich es vielleicht formulieren wollen.“ (StrafverteidigerInnen\1609934831-20201113_stv-a: 143)
Bei der Wahrnehmung der Gewaltbereitschaft gelangten die Expert:innen zu keinem einheitlichen Ergebnis. Zunächst ließ sich feststellen, dass die Expert:innen, die sich zur Gewaltentwicklung gegenüber Rettungskräften äußerten, dieses Phänomen als absolutes Novum empfanden und aufgrund des nahezu ausnahmslos wahrgenommenen Anstiegs der Gewalt auch die Gesetzesentwicklung als angemessen betrachteten. Anders erfolgte die Beurteilung jedoch, wenn es sich um Polizeibeamt:innen als Opfer handelte.
Das Gros der Expert:innen aus der Polizei nahm sowohl einen Zuwachs an gewalttätigen Handlungen als auch eine zunehmende Intensität der Angriffe wahr. Einer Ansicht nach seien bei körperlichen Auseinandersetzungen nun auch vermehrt Waffen im Gebrauch. Nur vereinzelt vertraten Polizeibeamt:innen eine abweichende Position und lehnten dabei grundsätzlich einen Anstieg hinsichtlich der Quantität ab.
Auch der Großteil der Richter:innen nahm eine steigende Anzahl an Verfahren, insbesondere im Bereich von Unterbringungssachen und im Umgang mit Polytoxikomanen wahr. Einige Expert:innen vermerkten dabei zudem ein gesteigertes Aggressionspotenzial. Interessant erschien auch, dass einige Richter:innen ihre eigene Einordnung reflektierten und betonten, dass die aufgezeigte Entwicklung zugleich aus einem veränderten Anzeigeverhalten resultieren könne.
Auffällig war weiterhin, dass einige Richter:innen versuchten, den Wandel auf gesellschaftliche Ereignisse, wie die Corona- oder sog. Flüchtlingskrise zurückzuführen. Erstere habe beispielsweise bei einigen Bürger:innen eine allgemeine Unzufriedenheit mit staatlichen Maßnahmen hervorgerufen. Bei letzterem wurde betont, dass in den Herkunftsländern der Geflüchteten oftmals ein anderes Bild und Verhältnis zur Polizei bestehe. Die Expert:innen problematisierten, dass in diesen Ländern ein eher von Gewalt geprägtes Verhältnis bestehe und auch weibliche Amtsträger:innen nicht anzutreffen seien.
Innerhalb der Gruppe der Vertreter:innen der Staatsanwaltschaft ließ sich ebenfalls keine klare Tendenz feststellen. Ein Teil der Staatsanwält:innen sah keinen Anstieg der Quantität und Qualität der Gewalt. Andere wiederum sahen eine Zunahme hinsichtlich beider Aspekte, auch im Rahmen der Jugendkriminalität, während andere nur einen Anstieg in Bezug auf die Quantität oder die Qualität registrierten. Ein interessanter Aspekt, der herangetragen wurde, ist die wahrgenommene zunehmende Gewaltbereitschaft von Frauen.
Ein Anstieg in puncto zunehmender Begehung von Widerstandstaten wurde demgegenüber von den befragten Strafverteidiger:innen nicht verzeichnet. Unter Bezugnahme auf Versammlungskontexte verwiesen sie darauf, dass im Vergleich zu früher weniger gewalttätig agiert werde. Andere Expert:innen aus diesem Lager erklärten sich eine wahrgenommene Zunahme von Gewalt gegenüber Polizeibeamt:innen nicht anhand eines zunehmend delinquenten Verhaltens, sondern führten diese wie die Richter:innen auf ein verändertes Anzeigeverhalten der Beamt:innen zurück.
„Ich persönlich gehe davon aus, aber das ist tatsächlich auch eine persönliche Annahme, dass sich insgesamt das Anzeigeverhalten verändert hat. Dass also seitens der einzelnen Beamten auch sensibler mit dem Thema umgegangen wird und dass bei möglicherweise insbesondere bei kleineren Verfehlungen tatsächlich die Schwelle, hier eine Anzeige zu erstatten, etwas gesunken ist.“ (StrafverteidigerInnen\1612266490-20210115_stv: 7-9)
2. Notwendigkeit der Neuregelung
Die Polizeibeamt:innen standen der Gesetzesänderung überwiegend positiv gegenüber und sahen eine klare kriminalpolitische Notwendigkeit der Neuregelung. Als Hauptargument wurde jedoch keine Regelungslücke angeführt, sondern ein wahrgenommenes Defizit hinsichtlich strafrechtlicher Konsequenzen im Sinne der Verfolgung und der ausgeurteilten Strafhöhen bei entsprechenden Sachverhalten beschrieben, die Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe zum Gegenstand haben. Eine wiederkehrende Argumentationslinie, die dominierte, lässt sich in folgendem Zitat sehr deutlich veranschaulichen:
„Ich weiß gar nicht, ob sie zwingend notwendig gewesen ist. Grundsätzlich begrüße ich sie, aber vielleicht könnte man auch sagen, dass es ein Problem in der Rechtsanwendung gewesen ist, denn wir hatten ja auch vorher eigentlich schon Vorschriften, die Gewalt oder Widerstand gegenüber Polizeibeamten dann oft unter Strafe gestellt hat und vielleicht war es auch eher ein Problem der Rechtsanwendung, was wir oftmals erlebt haben, dass halt Delikte zum Nachteil von Polizeibeamten unbestraft geblieben sind.“ (PolizeibeamtInnen\1609940193-20200623_e_pol: 7)
Das Bestehen etwaiger Strafbarkeitslücken vor der Gesetzesänderung wurde von den Polizeibeamt:innen verneint. Alle relevanten Fallgestaltungen seien bereits vor der Novellierung von den Vorschriften der Körperverletzungsdelikte nach den §§ 223 ff. StGB als auch durch die Sondervorschriften der §§ 113 ff. StGB erfasst gewesen. Aus gleichem Grund zweifelten auch die Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen an der kriminalpolitischen Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Vereinzelt sahen sie einen Mangel darin, dass die schon bestandenen Strafrahmen zumindest bei schwerwiegenden Delikten hätten besser ausgeschöpft werden müssen. Andere hielten dem jedoch entgegen, dass es „nur wenig Gerichte [gibt], bei denen man die Befürchtung haben muss, dass sie Delikte gegen Polizeibeamte grundsätzlich als Bagatellen ansehen.“[91]
Hinsichtlich der Sanktionen wurde von einigen Polizeibeamt:innen hervorgehoben, dass es ein „Vorteil“[92] sei , dass die Einführung der Mindestfreiheitsstrafe bei tätlichen Angriffen die Verhängung einer Geldstrafe nun zumindest erschwere. Unter den Verterter:innen der Staatsanwaltschaft divergierten die Sichtweisen. Befürworter:innen erklärten, dass die Verhängung von Freiheitsstrafen aufgrund der angedrohten Mindestfreiheitsstrafe in Fällen, in denen „die tätliche Gewalt im Vordergrund gestanden habe einfacher und schneller“[93] erfolgen könne, während Kritiker:innen das Strafmaß für „oftmals überzogen“[94] bzw. „nicht angezeigt“[95] bei Sachverhaltskonstellationen hielten, „in denen [mit Blick auf [die] eingetretenen Verletzungsfolgen auf Seiten der eingesetzten Kräfte] gar nicht viel passiert“,[96] wodurch „dem Staatsanwalt und somit auch dem Gericht die Gelegenheit genommen [wird], da mit mehr Augenmaß drauf zu gucken.“[97] Gleicher Meinung waren auch die Strafrichter:innen.[98]
Die befragten Polizeibeamt:innen führten als weiteres Hauptargument für die Gesetzesänderung vielfach die besondere Schutzbedürftigkeit von Einsatzkräften an. Sie führten dies unter anderem auf die proklamierte Zunahme der „Anzahl der tätlichen Angriffe beziehungsweise der Widerstandshandlungen“[99] und damit korrespondierend „die Tendenz […] zu einem respektlosen Umgang mit Einsatzkräften oder mit Rettungskräften“[100] im Allgemeinen zurück. Diese Zunahme des Fallaufkommens wurde dabei in den Zusammenhang mit der gesetzgeberischen Intention „eine[r] Erhöhung oder Wiederherstellung des Respekts vor der Arbeit von Einsatz- und Rettungskräften“[101] gesetzt. Ein Teil der Staatsanwält:innen bemängelten, dass Einsatzkräfte der Polizei „keinerlei Respekt in der Bevölkerung genießen und ständig beleidigt und angegangen werden“[102]. In diesem Zusammenhang hoben einige die Rolle der Rettungskräfte, bei denen ein Anstieg von „Tätlichkeiten“[103] beklagt wurde, besonders hervor.
Die befragten Polizeibeamt:innen hoben zudem den symbolischen Charakter hervor und werteten das Gesetz als „politisches Signal“[104], durch das der Gesetzgeber „Polizeibeamt[:inn]en und auch den Rettungsdiensten den Rücken gestärkt hat“,[105] wodurch die Politik „Wertschätzung […] und [einen gewissen] Fürsorgegedanke[n] […] gegenüber der Exekutive“[106] zum Ausdruck brachte. Besonders hervorgehoben wurde die subjektive Wirkung nach innen, die sich in einen Kontext mit dem bereits beschriebenen Rechtsanwendungsdefizit gleichsetzen lässt, was das folgende Zitat verdeutlicht:
„Ich glaube, für die Kolleg[:inn]en, die draußen vor Ort sind, ist es schon notwendig, dass die halt auch ein Gefühl haben, dass die Legislative auch, sage ich mal, etwas für die Exekutive tut, um sie auch in Schutz zu nehmen.“ (PolizeibeamtInnen\1609940196-20200716_e_pol_1_0: 11)
Die von dem Gesetz ausgehende Symbolkraft wurde nur teilweise von den Staatsanwält:innen aufgegriffen bzw. mit Blick auf die kriminalpolitische Notwendigkeit kaum thematisiert, sodass ihr bei einer Gesamtbetrachtung eine eher untergeordnete Rolle zukommt. Die Strafrichter:innen bewerteten den symbolischen Gehalt der Neureglung unterschiedlich. Einige sahen den Symbolgehalt, dass durch die Gesetzesänderung „ein Zeichen gesetzt wird“[107] und sich der „Gesetzgeber […] hinter seine Beamten stellt“,[108] als positiv:
„Und dann nehme ich Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe. Strafrahmen allein schützen halt nicht. Es ist eine gute Symbolik, weil es einfach noch mal deutlich macht, dass der Beamte hier nicht bei einer Vollstreckung auftritt, sondern bei einer, in Anführungsstrichen, allgemeinen Diensthandlung, er also sozusagen noch weniger damit vielleicht rechnet, angegriffen zu werden. Also der Vollstreckende, der rechnet vielleicht mit Widerstand, der schlicht Diensthandelnde eben nicht, insofern ist das gut und richtig. Aber der Strafrahmen allein bringt halt nichts.“ (1606747142-20200625_e_straf_ri: 139)
Demgegenüber war der symbolische Gehalt auch Gegenstand von Kritik. Ein:e Strafrichter:in betrachtete die Verschärfung als reine Symbolpolitik, die aus „politischem Kalkül“[109] erfolgt sei.
Die befragten Strafverteidiger:innen stellten die kriminalpolitische Notwendigkeit nahezu einhellig in Abrede. Das Votum fiel in der Regel sehr knapp aus – so konstatierten die Expert:innen, dass die Änderung „überhaupt nicht“[110] notwendig gewesen sei. Zum Teil wurde sie mit den Attributen „unnütz“[111] sowie „verfassungsrechtlich unzulässig“[112] versehen. Auch sie sahen keine Strafbarkeitslücken, konnten aber auch ein Nichtausschöpfen der bestehenden Strafrahmen nicht bestätigen. Sie schilderten den subjektiven Eindruck, dass es eine „Neigung von Richtern und Richterinnen [gebe], Sachverhalte, die Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe zum Gegenstand haben, im Vergleich zu anderen Delikten höher zu bestrafen“.[113] Korrespondierend mit der Argumentationslinie zum Rechtsanwendungsdefizit verwiesen die Expert:innen der Strafverteidigung vielfach darauf, dass sich ein Schutzbedürfnis auch nicht aus einem proklamierten Anstieg von gewaltförmigen Handlungen gegenüber Einsatzkräften ableiten lasse. Dieser Umstand sei mitunter darauf zurückzuführen, dass die PKS gewissen Verzerrungsfaktoren unterliege und dies insbesondere auf ein verändertes Anzeigeverhalten zurückgeführt werden könne. In diesem Zusammenhang setzten die Expert:innen die Debatte zum Teil in einen allgemeinen politischen Kontext und stellten die kriminalpolitischen bzw. präventiv polizeilichen Entwicklungstendenzen als wenig sachorientiert, sondern reflexartig dar. Insgesamt bewerteten die Strafverteidiger:innen das Gesetzgebungsvorhaben vielfach als „Symbolpolitik“,[114] bei der mit „obrigkeitsstaatlichen Maßnahmen“ versucht werde, „eine besondere Wertschätzung für eine Berufsgruppe der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu kreieren“[115] und bemängelten, dass hieraus eine Diskrepanz zu der erlebten Praxis resultiere.
3. Bewertung des Gesetzesziels
Gleichermaßen wurde mit den Expert:innen diskutiert, ob das Ziel der Gesetzesänderung, den Schutz der Vollstreckungsbeamt:innen und Rettungskräfte zu verbessern, durch das Gesetz erreicht wurde oder ob sonstige Maßnahmen Gegenstand weiterer Überlegungen sein sollten.
Die befragten Polizeibeamt:innen führten hauptsächlich generalpräventive Aspekte an und beurteilten die Erfolgsaussichten danach, inwiefern Täter:innen einer Strafverfolgung zugeführt und letztlich zu einer (empfindlichen) Strafe verurteilt werden.
„Ja, davon bin ich überzeugt, weil es zum einen ja eine generalpräventive Wirkung hat, auch wenn es vielleicht nur ein Prozent derjenigen betrifft, die potenzielle Täter sind und zum zweiten glaube ich auch, dass es eine Sensibilisierung der Justiz gab. Weil, wenn ein Straftatbestand ein grundsätzlich höheres Strafmaß schon von Grund auf ansetzt, als ein Körperverletzungsdelikt beispielsweise, dann bin ich bei der juristischen Beurteilung ja schon gezwungen, auf dieses Mindestmaß zurückzugreifen. Und insofern glaube ich schon, dass es dazu beiträgt. (PolizeibeamtInnen\1609940204-20200904_e-pol: 31)
Außerdem führten Polizeibeamt:innen zum Teil an, dass die Gesetzesänderung weitere Spielräume für freiheitsentziehende Maßnahmen eröffne, die wiederum geeignet seien, Einfluss auf die Täter:innen auszuüben.[116]
Auch die Mehrheit der Staatsanwält:innen betonte den repressiven Aspekt und sah in der Strafrahmenerhöhung weniger die Gefahr, dass solche Delikte „bagatellisiert“[117] werden. Nur selten bezogen sie sich auf den präventiven Charakter der Gesetzesänderung. Strafrichter:innen, die keinen Rückgang der Delikte sahen, bezweifelten die generalpräventive Wirksamkeit oder negierten diese. Zur Begründung wurden mannigfaltige Aspekte herangeführt, die im Kern die abschreckende Wirkung von Strafe in Frage stellten. Teils vertraten auch Expert:innen aus den anderen Professionen diese Ansicht, indem sie auf empirische Erkenntnisse aus der Sanktionsforschung verwiesen und diese zum Teil in den Kontext phänomenologischer Besonderheiten setzten.
„Die Androhung höherer Strafe, das sagen alle wissenschaftlichen Statistiken, führt nicht dazu, dass Straftaten in einem geringeren Maße dann auch begangen werden.“ (StrafverteidigerInnen\1609934834-20201118_stv: 19)
Von den Strafverteidiger:innen wurde allgemein bezweifelt, dass das Strafrecht überhaupt eine Verbesserung des Schutzes von Einsatzkräften leisten könne.
„Und Pragmatismus, Kosteneffizienz und ähnliche Dinge, ich bin ja nicht blauäugig, ja natürlich sind das die Dinge die dann möglicherweise in so einem Gesetzgebungsverfahren nicht nur eine untergeordnete, sondern eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ich schwinge mich jetzt mal zu was ganz Gemeinen auf. Wir leben in einer Gesellschaft, die der Auffassung ist, dass Menschen, die wir zur Bewältigung einer sogenannten Jahrhundertkrise dringend benötigen, dadurch gesellschaftlich Respekt und Anerkennung bekommen, dass die Gesellschaft abends um neun auf den Balkon tritt und applaudiert. Das ist auch eine sehr kostengünstige Lösung. Davon hat nur keiner was.“ (StrafverteidigerInnen\20201210_stv: 29)
Korrespondierend mit den dargestellten Argumentationssträngen sahen die Expert:innen unterschiedliche Möglichkeiten, den Schutz von Einsatzkräften zu verbessern. Die aufgeführten Aspekte lassen sich in repressive und präventive Maßnahmen untergliedern. Die befragten Polizeibeamt:innen legten den Fokus auf eine konsequente Anwendung der Vorschriften und Verurteilung, sowie auf Nebenstrafen, wie das Fahrverbot (§ 44 Abs. 1 StGB). Vereinzelt sprachen Expert:innen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft die zeitliche Dauer von polizeilichen Ermittlungen bzw. Strafverfahren an und schlugen vor, entsprechende Fälle zu priorisieren und zeitlich zu beschleunigen, damit „die Strafe auf dem Fuße folgt […]“.[118]
Deutlich häufiger sprachen die Expert:innen präventive Maßnahmen an. Dazu gehörte eine Verbesserung personeller Ressourcen bei der Polizei, auch mit Blick auf die (Schutz-)Ausstattung, Transparenz, Fehlerkultur sowie ausbildungsspezifische Inhalte und Schulungen.
Eine weitere Strafschärfung wurde von fast allen Interviewpartner:innen abgelehnt bzw. als nicht notwendig erachtet. Die befragten Polizeibeamt:innen stellten größtenteils darauf ab, dass die Gesetze und der bestehende Strafrahmen zunächst umgesetzt werden solle. Ein weiterer Reformbedarf würde sich dann anhand der Verurteilungen offenbaren. Ein:e Polizeibeamt:in lehnt eine weitere Anhebung der Mindeststrafe des tätlichen Angriffs aufgrund der Nebenfolgen, die mit einer Verurteilung bzw. Eintragung in das Führungszeugnis einhergehen, ab. Andere Polizeibeamt:innen stellten wiederum den generalpräventiven Charakter eines solchen Gesetzes in Frage.
In der Strafverteidigung wurde eine Anhebung der Mindeststrafe des tätlichen Angriffs auf sechs Monate teilweise vor dem Hintergrund abgelehnt, dass eine Umwandlung in eine Geldstrafe nach § 47 StGB dadurch unmöglich werde. Bereits die aktuelle Mindeststrafandrohung von drei Monaten wurde von einem:einer Strafverteidiger:in als falsch bezeichnet. Im Hinblick auf die Einführung eines weiteren Regelbeispiels, insbesondere für den hinterlistigen Überfall, wurde aufgeworfen, dass es sich hierbei nur um Einzelfälle handele. Auf diese könne man bereits aufgrund der aktuellen Gesetzeslage hinreichend eingehen.
Lediglich zwei Expert:innen der Richterschaft äußerten sich zu einer weiteren Strafschärfung. Dabei sah ein:e Richter:in die Notwendigkeit darin, zunächst die Entwicklungen der letzten Gesetzesänderung in der Justiz zu beobachten, während der:die andere eine Verbesserung des Schutzes von Polizeibeamt:innen durch eine weitere Gesetzesverschärfung bezweifelte.
Auch die befragten Staatsanwält:innen sprachen sich mehrheitlich gegen eine weitere Strafschärfung aus. Der bestehende Strafrahmen wurde bereits als „abschreckend genug“[119] betrachtet und eine weitere Strafschärfung als „zu weitgehend“[120] bezeichnet. Es sei möglich, einzelne Tatmodalitäten wie bspw. einen hinterlistigen Überfall, anhand der §§ 223, 224 StGB zu würdigen. Nach einem:einer Staatsanwält:in würden sich Probleme eher aus praktischer Sicht ergeben (Bsp.: Fehlerhafter Ermittlung). Ein:e andere:r Staatsanwält:in sah aufgrund der bereits vorhandenen konsequenten Strafverfolgungspraxis das Erfordernis sozialpolitischer Maßnahmen.
Nur vereinzelt sahen Staatsanwält:innen einen Nutzen in einer weiteren Strafschärfung. Dabei wurde jedoch von einem:einer Expert:in die Mindeststrafe herausgenommen und betont, dass eine Anhebung der Höchststrafe eine flexiblere Einzelfallentscheidung ermögliche. Ein:e andere:r Staatsanwält:in stellte wiederum darauf ab, dass er:sie eine Verschärfung im Hinblick auf Regelbeispiele in Ordnung finde, aber nicht die Notwendigkeit einer Erhöhung der Mindeststrafe in Bezug auf den tätlichen Angriff sehe.
Insgesamt ließ sich daher feststellen, dass die Mindeststrafe und der aktuelle Strafrahmen mehrheitlich als ausreichend erachtet wird. Zur Verbesserung des Schutzes von Vollstreckungsbeamt:innen und ihnen Gleichgestellten wurden von den Expert:innen größtenteils Maßnahmen auf anderer Ebene gefordert. Gerade eine Anhebung der Mindeststrafe beim tätlichen Angriff wurde als zu unflexibel angesehen.
4. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte § 113 StGB
Gegenstand innerhalb der Expert:innenbefragung bildete ebenfalls die normative Umgestaltung des Widerstandsparagraphen. Neben den Elementen der Rechtsdogmatik, wurden die einzelnen Tathandlungen in den Blick genommen, die zu einer Tatbestandsverwirklichung führen.
a) Typische Widerstandhandlungen
Die befragten Expert:innen der Polizei auf Sachbearbeiter- sowie auf Führungsebene schilderten sowohl hinsichtlich der Rahmenbedingungen als auch der Handlungen, die sie als Widerstandshandlungen bewerteten, ähnliche Sachverhaltskonstellationen. In Übereinstimmung zu den empirischen Erkenntnissen ereignen sich Widerstände demzufolge häufig in Situationen, in denen Polizeibeamt:innen eine Person bspw. im Rahmen einer (körperlichen) Durchsuchung oder zur Blutprobenentnahme festhalten bzw. fixieren, (vorläufig) fest- bzw. in Gewahrsam nehmen, wobei letzteres häufig im Zusammenhang mit der Alkoholisierung bzw. des berauschten Zustands der in Gewahrsam genommenen Person steht, da diese den Grund für die polizeiliche Maßnahme bildet.
Als typische Widerstandshandlungen benannten alle Expert:innen häufig das Sich-Sperren, indem die von der Maßnahme betroffene Person ihre Arme durch Muskelanspannung vor dem Körper verschränkt, das Sich-Drehen, Sich-Winden, Sich-gegen-etwas/jemanden Stemmen, Sich-fallen-lassen, Losreißen sowie das Schubsen. Es handelte sich damit in der Mehrzahl der Fälle um Handlungen, die als Ausdruck einer Weigerungshaltung an der polizeilichen Maßnahme aktiv mitzuwirken begriffen werden kann, ohne dass es zu körperlichen Schädigungen kommt. In der Praxis hat sich zum Teil die Bezeichnung des sog. „Zappelwiderstandes“[121] für entsprechende Sachverhaltskonstellationen etabliert. Die Tatbestandsvariante des Widerstandsleistens durch Drohung mit Gewalt spielte gemessen an den beschriebenen Fällen eine untergeordnete Rolle. Dieser Umstand dürfte maßgeblich auf die Herauslösung des tätlichen Angriffs zurückzuführen sein, der nunmehr eine klare Zuordnung einer Tathandlung zu einer Tatbestandsvariante erfordert.
Die geschilderten Handlungen im Konglomerat des „Sich-Sperrens“ stellten sich mit Blick auf die rechtliche Bewertung vor dem Hintergrund der Abgrenzung eines straflosen sog. „passiven“ zum strafbaren „aktiven“ Widerstand als problematisch dar. In diesem Kontext ist zu konstatieren, dass die Grenzen fließend sind. Als maßgeblich gilt der Grad körperlicher Aktivität im Sinne des Kraftaufwands der „Gegenwehr“, wobei teils auf die Intensität der Kraftentfaltung, die seitens der Polizeibeamt:innen zur Fortsetzung der Maßnahme notwendig ist, abgestellt wurde.[122] Andererseits stellte sich heraus, dass die Norm vor allem im Stadium der ersten polizeilichen Bewertung mit Blick auf das Tatbestandsmerkmal der „Gewalt“ einen erheblichen Beurteilungsspielraum eröffnet, der sich teilweise auch in Bewertungsdiskrepanzen niederschlagen kann, wie folgendes Zitat verdeutlicht.
„Manchmal verführt es die Kollegen auch dazu, wenn er sich passiv verhält, den als Widerstand anzuzeigen, dann sage ich: Leute, das ist kein Widerstand, weil er hält eigentlich nur seine Arme fest, damit er nicht gefesselt wird. Es ist unser Problem, ihn da rauszubringen, aber das ist kein Widerstand. Das kann vielleicht eine Nötigung sein unter Umständen, aber kein Widerstand.“ (PolizeibeamtInnen\1609940202-20200810_e_pol_b: 91)
Insgesamt ließ sich nach der Meinung der Expert:innen durch die Einordnung der strafbaren Handlungen deutlich die Entwicklungstendenz erkennen, dass durch die Herauslösung des tätlichen Angriffs eine Verengung des rechtsdogmatischen Anwendungsbereichs der Norm stattgefunden hat:
„[…] der einfache Widerstand, […] eigentlich mittlerweile nur noch begrenzt auf die Fälle, dass man sich körperlich sperrt und versucht irgendwie rauszuwinden. Das ist der einzige Fall des § 113 StGB. Alles andere, sobald eine aktive Handlung wie Schubsen oder der Versuch mit dem Bodycheck oder versuchen mit dem Knie irgendwie in Richtung der Beamten zu treten oder mit dem Fuß in Richtung der Beamten auszuschwingen. All diese Dinge sind mittlerweile vom § 114 StGB erfasst. Bedeutet also, also ich meine das Einzige, was sich dann quasi in der rechtsdogmatischen Praxis ändert, ist, dass der Anwendungsbereich des § 113 StGB enorm zurückgegangen ist und ausschließlich beschränkt ist auf diese Fälle des sich Sperrens, des Muskelanspannens, damit man nicht quasi gegriffen werden kann und des sich Versuchens aus einem Polizeigriff zu winden, zu befreien.“ (StaatsanwältInnen\1620380329-21200430_sta: 37)
b) Rechtmäßigkeit der Vollstreckungshandlung
Die Befragungen innerhalb der Expert:innenkreise wiesen bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit von Dienst- bzw. Vollstreckungshandlungen innerhalb von Widerstandsdelikten kein einheitliches Bild auf. Während von der Mehrheit der Staatsanwält:innen und Richter:innen eingebracht wurde, dass sie Handlungen nicht bzw. lediglich beim Vorliegen von Anhaltspunkten prüfen, werden diese von Vertreter:innen der polizeilichen Praxis einer Rechtmäßigkeitskontrolle unterzogen und auch teilweise über interne Mechanismen geprüft.
„Na ja, es wird ja immer die Maßnahme analysiert, war die verhältnismäßig? War das das mildere Mittel? Also dieser stufenweise Aufbau dieses Maßnahmenkataloges. Und dann kommt halt der Dienstgruppenleiter schon mal zu dem Entschluss, also die Maßnahme war eigentlich nicht rechtmäßig und wir würdigen es in der Sachbearbeitung auch noch mal […] doppelte Qualitätssicherung, also halt die Erkennbarkeit, hat er sich ausgewiesen […] usw. Und dann, war die Maßnahme klar ersichtlich? War es nicht ersichtlich? Und solche Geschichten. Das prüfen wir eigentlich praktisch doppelt auch aus dem Hintergrund heraus, ich kann ja vom Schreibtisch aus nicht entscheiden, welche Zielrichtung hatte denn der Kollege? Es gibt ja immer verschiedene Maßnahmen, es gibt ja eine Maßnahme, die aus verschiedenen Gründen treffen kann. Und da müsste man schon sagen, warum wollt ihr den? Wollt ihr eine Identitätsfeststellung machen? Wollt ihr wohl einen Platzverweis aussprechen? Was wollt ihr denn eigentlich mit dem? Und das müssen wir dann schon sagen. Und deswegen prüfen wir das dann auch noch mal im wahrsten Sinne des Wortes doppelt.“ (PolizeibeamtInnen\1609940202-20200810_e_pol_b: 93-95)
Für die Strafverteidiger:innen war die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung von großer Bedeutung, da sie eine Möglichkeit darstellt, eine Strafbarkeit de:r Mandant:innen nach § 113 StGB abzuwenden. Kritisiert wurde insbesondere eine fehlende Kommunikation mit dem Gegenüber seitens der Vollstreckungsbeamt:innen, die einen Eingriff unter gegebenen Umständen rechtswidrig werden lassen kann.
„Also was man schon merkt ist, ich habe jetzt gerade eine Akte im Kopf, da sagt die Polizei: Also wir haben ihm gesagt, er soll jetzt weggehen, dann ist er nicht weggegangen, dann haben wir ihn sofort zu Boden gebracht. […] Und da ist sozusagen aus meiner Sicht die Vollstreckungshandlung rechtswidrig. Ja, weil, es gab gar keine verbale Kommunikation, jedenfalls nach Aktenlage.“ (StrafverteidigerInnen\1609934836-20201223_stv: 375-377)
c) Wegfall der Verwendungsabsicht – § 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StGB n.F.
Ebenfalls wurde der Wegfall der Verwendungsabsicht einer grundsätzlichen Bewertung unterzogen und die generelle Praxisrelevanz des Regelbeispiels kritisch in den Blick genommen.
Insbesondere Polizeibeamt:innen begrüßten diese spezielle Gesetzesänderung vor dem Hintergrund der Beweis-praktikabilität und der damit einhergehenden Arbeitserleichterung, da die Verwendungsabsicht „kaum nachweisbar“[123] sei und die Annahme des besonders schweren Falls nunmehr leichter bereits im Stadium des Ermittlungsverfahrens begründet werden könne.
„Für uns ist das positiv, weil eine Verwendungsabsicht nachzuweisen, da muss er ja schon was gemacht haben. Ich meine, wenn er zusticht, dann ist klar, dann hat er die Absicht wahrscheinlich gehabt, ne? Aber, wenn er das Ding bloß mitführt, und es ist ja trotzdem gefährlich, ihm dann zu sagen, das hättest du vielleicht noch mal eingesetzt, wenn es denn so weit gekommen wäre, das ist halt ich sage mal so ein zahnloser Tiger, ne? Weil der sagt: Das habe ich nicht verwenden wollen. Insofern ist das zwar eine Schärfung des Ganzen, aber die Kollegen sind geschützter dadurch, wenn der eine Waffe mitführt, dann müssen wir nicht mehr beweisen, dass er sie verwenden wollte.“ (PolizeibeamtInnen\1609940202-20200810_e_pol_b: 97)
Einige Polizeibeamt:innen zogen Vergleiche zu anderen Tatbeständen, die ebenfalls einen besonders schweren Fall vorsehen und eine äquivalente Formulierung aufweisen, wie bspw. der besonders schwere Fall des Diebstahls. In diesem Zusammenhang wurde die Änderung des Regelbeispiels befürwortet und als rechtsdogmatisch konsequent betrachtet.
Auch einige Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen begrüßten den Wegfall der Verwendungsabsicht. Dabei wurde zum Teil mit der erhöhten abstrakten Gefährlichkeit in solchen Sachverhaltskonstellationen argumentiert, die aus der unmittelbaren Griffbereitschaft zur Waffe oder des gefährlichen Werkzeugs bzw. „alleine diese Verfügbarkeit eben eines solchen Gegenstandes“[124] abgeleitet wurde. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Argumentation fand hingegen weniger statt.
In der Mehrzahl führten die Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen ebenso wie die Polizeibeamt:innen die Praxistauglichkeit des Regelbeispiel ins Feld.
„In der Sache natürlich sehr sinnvoll. Das Problem all dieser wunderschönen Tatbestände ist ja immer, dass sie praxistauglich sein müssen. Und bestimmte kann ich nun einmal nicht mehr beweisen. Das ist auch, gibt es Etliches im Strafgesetzbuch, wo ich sagen muss, wenn er es nicht gesteht, kann ich es ihm nie nachweisen. Und praktikable Tatbestände und gerade in diesem Bereich müssen so ausgelegt sein, dass sie wirklich praktikabel sind.“ (StrafrichterInnen\1606747141-20200812_e_strafri: 97)
Gleichwohl befürworteten sie nicht automatisch den Wegfall der Verwendungsabsicht. Vielfach wurde zwischen der Alternative des Beisichführens einer Waffe oder eines Werkzeugs unterschieden. Während der Wegfall der Verwendungsabsicht im Hinblick auf die Waffe auf Verständnis traf, stieß die Änderung bzgl. des Merkmals des gefährlichen Werkzeugs mehrheitlich auf Kritik. Die Expert:innen verwiesen darauf, dass die Auslegung des Begriffs nunmehr wie beim Diebstahl mit Waffen nach § 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Alt. 2 StGB und beim schweren Raub nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Alt. 2 StGB problematisch sei. Dadurch entstehe letztlich die Gefahr, dass auch Alltagsgegenstände als gefährliche Werkzeuge eingeordnet werden. Bei der Frage nach der Lösung des Problems, legten die Staatsanwält:innen und Richter:innen unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zugrunde. Hierbei wurde unter anderem auf objektive Komponenten wie z.B. die Gefährlichkeit des Gegenstands i.S.e. Waffenähnlichkeit oder Waffenersatzfunktion, die Geeignetheit Verletzungen hervorzurufen und auf subjektive Komponenten wie eine (unterstellte) Verwendungsintention abgestellt.
Vertreter:innen der Strafverteidigung betrachteten die Änderung des Regelbeispiels im Gros kritisch und wiesen darauf hin, dass sie die Verteidigung bei entsprechenden Vorwürfen erschwere und Beschuldigte im Falle einer Verurteilung mit gravierenden Folgen zu rechnen hätten. Als Argument wurde teilweise ins Feld geführt, dass der Gesetzgeber hiermit eine Rechtslage geschaffen habe, die dem verfassungsrechtlich verankerten Bestimmtheitsgebot zuwiderlaufe und mit dem Schuldprinzip nicht übereinstimme. Sie wiesen auf die praktische Konsequenz bei bestimmten Sachverhaltskonstellationen hin, „[…] die vorher vielleicht auch nur ein einfacher Widerstand gewesen wären und jetzt gleich automatisch eben qualifiziert sind […]“.[125] Dies sei auf die „uferlos[e]“[126] Ausweitung des Tatbestandes zurückzuführen.
Gesamtheitlich betrachtet lässt sich hinsichtlich der Praxisrelevanz konstatieren, dass diese von den Expert:innen aus allen Lagern sowohl bezogen auf Waffen als auch auf gefährliche Gegenstände, als gering eingeschätzt wird.
„Spielt bei mir in der Praxis, ich sage es Ihnen offen, spielt kaum eine Rolle. […] Sage ich Ihnen ganz offen, ist mir nicht geläufig, das meiste sind tatsächlich Widerstandshandlungen nach einer Vortat, wobei die Anzeige die Vortat nicht darlegt, Stichwort Ladendiebstahl oder irgendwas anderes. Oder Widerstandshandlungen unter Drogen beziehungsweise Alkohol, die dann eskalieren, das ist eigentlich das Massengeschäft.“ (StaatsanwältInnen\1612266490-20200804_e_sta: 83)
d) Die gemeinschaftliche Tatbegehung – § 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 StGB n.F.
Im Rahmen der Diskussion um das Regelbeispiel der gemeinschaftlichen Tatbegehung berichteten Polizeibeamt:innen, Staatsanwält:innen und Richter:innen, dass sie von dem Regelbeispiel in der Praxis weniger Gebrauch machen und begründeten dies zum Teil mit der vornehmlichen Interaktion mit Einzeltäter:innen. Darüber hinaus verwies die Mehrheit der Staatsanwält:innen im Hinblick auf die fehlenden praktischen Berührungspunkte mit dem Regelbeispiel auf die typischen Sachverhaltsgegebenheiten der gemeinschaftlichen Tatbegehung (Bsp.: Großveranstaltungen, Versammlungen), welche die Zuständigkeit einer anderen (Sonder-)Abteilung zur Folge haben. Vor dem Hintergrund der „Solidarisierungseffekte“ bzw. gruppendynamischer Prozesse, die mit einer für die Polizeibeamt:innen gefahrerhöhenden Situationen assoziiert werden, wurde die Einführung des Regelbeispiels von diesen Expert:innenkreisen jedoch begrüßt. Eine gefahrenerhöhende Situation wurde u.a. in einem steigenden Aggressionspotential begründet.
„Das kann ich auch nur begrüßen, weil es langt schon, wenn ich einen Widerständler habe, bei einem zweiten Widerständler würde ich in der Regel immer eine zweite Streife, sogar eine dritte Streife brauchen. Und wenn die gemeinsam handeln, dann ist es wie bei der gefährlichen Körperverletzung letztendlich zu sehen. Die können sich in Anführungsstrichen hochschaukeln, absprechen, gemeinsam handeln und wenn Sie mal gegen zwei gekämpft haben allein, dann wissen Sie, was da los ist.“ (PolizeibeamtInnen\1609940202-20200810_e_pol_b: 107)
Ein positiver Effekt des Regelbeispiels könne sich einigen Polizeibeamt:innen zufolge insbesondere bei Versammlungslagen erzielen lassen, indem man einer fortschreitenden „Verrohung“ entgegenwirke.
„Also grundsätzlich finde ich es auch gut, dass es ein Qualifizierungstatbestand ist, weil das ja ein stückweit auch zu Verrohung dazugehört. Gerade aus soziologischer Sicht betrachtet habe ich auch das Gefühl, dass immer weniger Einzelpersonen und immer vermehrt soziale Gruppen, in welcher Form auch immer, dann den Polizeibeamten entweder schon direkt gegenüberstehen oder dann im Laufe der Tat zusammenrotten.“ (PolizeibeamtInnen\1609940204-20200904_e-pol: 73)
Anders äußerten sich die Strafverteidiger:innen, die mit der Einführung des Merkmals der gemeinschaftlichen Tatbegehung eine Aggravation von geringwertigen Handlungen wahrnahmen (Bsp.: Versammlungslagen wie Blockaden, bei denen sich die Demonstrationsteilnehmer:innen unterhaken und von der Polizei wegtragen lassen). Das Regelbeispiel wurde von ihnen mehrheitlich kritisiert, was teilweise mit der unzureichenden Normauslegung begründet wurde. Die weite Begriffsauslegung führe dazu, dass die subsumierbaren Tathandlungen außer Verhältnis zur angedrohten Strafe stünden.
„Also, wenn ich jetzt mal überlege, die Anklagen, die ich in letzter Zeit so verteidigt habe mit Demonstrationsgeschehen im Zusammenhang, [die] waren immer gemeinschaftlich angeklagt. […] Und damit auch gleich mit sechs Monaten Mindeststrafe.“ (StrafverteidigerInnen\1621428809-21200513_stv: 322-323)
5. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte § 114 StGB
Des Weiteren bildete das Herauslösen des tätlichen Angriffs aus dem § 113 StGB a.F. in einen eigenständigen Tatbestand (§ 114 StGB) einen wichtigen Themenkomplex bei der Befragung der Expert:innen. Neben dem Unrechtsgehalt, Rechtsgut und typischen Tatkonstellationen wurde hierbei insbesondere die Definition des tätlichen Angriffs sowie deren Folgen für die Strafverfolgung von den Expert:innen in den Mittelpunkt gestellt.
a) Unrechtsgehalt und Rechtsgut
Im Hinblick auf die Frage des Unrechtsgehalts des tätlichen Angriffs im Vergleich zum Widerstandleisten bildete sich bei den Expert:innen aus der Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter:innenschaft ein Konsens dahingehend, dass dem tätlichen Angriff ein höherer Unrechtsgehalt zugeschrieben wurde.
Ein Argumentationsstrang differenziert Widerstandshandlungen von tätlichen Angriffen. Dabei wurde ein Grundverständnis dahingehend deutlich, dass Widerstandshandlungen in der konkreten Gewaltanwendung eher passiv seien und sich nicht gegen den Körper einer anderen Person richten. Dementsprechend leiteten die Expert:innen, die diese Auffassung vertraten, daraus ab, dass die motivationale Intention der Handlungen auf die Schädigung der Kräfte abziele.
„Also wenn man sich in die Lage versetzt, der „Widerstand“, das impliziert ja schon, das Wort oder der Wortsinn impliziert ja schon, dass ich mich sozusagen gegen etwas wehre, was ich vielleicht für Unrecht halte. Das lassen wir mal dahingestellt. […] Und der tätliche Angriff hat im Wortsinn her einfach etwas Aktives, also dass ich sozusagen die Konfrontation suche. Und da bin ich, wenn ich mir das Unrecht so wie eine Leiter vorstelle, auf der Unrechtsleiter halt schon deutlich weiter oben. Sich wehren oder überhaupt mal initiieren, dass es zu einem Angriff kommt, das ist schon ein großer Unterschied.“ (StrafrichterInnen\1606747142-20200625_e_straf_ri: 35)
„Ja, also der Unterschied ist zum Beispiel, also wir sind immer abhängig von dem, was in der Akte steht. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand um sich tritt, weil er gerade ausrastet oder ob er gezielt versucht bei einem bestimmten, was weiß ich, beim Weg zum Streifenwagen noch mal jemanden gezielt zu treten in die Eier oder mit einer Kopfnuss eine zu verpassen, das ist noch mal eine eigene Qualität. Da würde ich auch sagen, gut das ist ein Angriff. Da ist ja jetzt auch keine Eskalation gerade, man sitzt auf der Rückbank gemütlich und könnte jetzt zum Gewahrsam fahren, aber der will sich noch mal messen. Ja, schwierig. Es ist schwierig auf jeden Fall.“ (StaatsanwältInnen\1617116679-21200316_sta: 155)
Expert:innen, die den zweiten Argumentationsstrang vertraten, bezogen die berufsgruppenbezogene Stellung mit ein. Das besondere Unrecht liege darin, dass in den Handlungen ein „[Aufbegehren] gegen eine staatliche Autorität“ stattfinde, worin gleichzeitig zum Ausdruck gebracht werde, dass man „die staatlichen Regeln nicht mehr anerkenn[t] und dazu bereit [ist], gegen den Staat, gegen die Regeln körperlich vorzugehen.“[127] Zum Teil wurde ergänzt, dass der Unrechtsgehalt bei Handlungen, die gegenüber Rettungskräften erfolgten, noch verwerflicher seien.
„[…] weil ein Polizeibeamter […] immer noch die Möglichkeiten beispielsweise des unmittelbaren Zwangs, körperliche Hilfsmittel und ähnliches [hat], um sich zur Wehr zu setzen. Aber der Rettungsdienstler oder der Feuerwehrler ist ja letztendlich diesen Übergriffen wirklich schutzlos ausgeliefert. Im Gegensatz zum Polizeibeamten, der das in keiner Weise hinnehmen muss. Aber natürlich auch entsprechend psychologisch geschult ist, der körperlich geschult ist mit Verteidigungsmöglichkeiten und ähnlichem.“ (PolizeibeamtInnen\1615294556-20200813_e_pol_c: 25)
Nur vereinzelt wurde von Expert:innen der Staatsanwaltschaft und Richter:innenschaft ein erhöhter Unrechtsgehalt des tätlichen Angriffs in Frage gestellt. Begründet wurde dies durch die Abgrenzungsschwierigkeiten, die den §§ 113, 114 StGB anhaften. Dabei wurde auf solche tätlichen Angriffe verwiesen, die aus der Interaktionsdynamik heraus entstünden. Es wurde überwiegend angezweifelt, ob diese Fallkonstellationen tatsächlich den vom Gesetzgeber vorgesehenen Unrechtsgehalt verkörpern, da sie als Reaktion auf eine Maßnahme im Sinne eines natürlichen Reflexes verstanden werden.
„Also finde ich schon höher, ja. Auf jeden Fall aber nicht immer. Wie gesagt […] ja, in den Fällen, wo es Abgrenzungsschwierigkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn jemand gefesselt wird, also wenn Polizeibeamte, das finde ich immer sehr schwierig, wenn die die Person fesseln, weil sie irgendwie sich nicht fesseln lässt, sondern bringt diese Person zu Boden. Und die Person zappelt rum und macht so mit den Armen und Beinen, zappelt halt mit den Armen und Beinen rum und versucht, diese unangenehme, die auch für jeden Menschen unangenehm ist, Situation, irgendwie zu klären, weil irgendwie der Kopf mit dem Gesicht auf dem Boden, auf der Straße liegt, da sich zu lösen, so als natürlich Reflex und das dann abzugrenzen zum Widerstand. Also diese Abgrenzungsfälle, wo man sich fragt, ist das ein Angriff.“ (StrafrichterInnen\20200709_e_strafri_b: 31-33)
Einige Strafverteidiger:innen sahen dies ähnlich. Im Regelfall zeichne sich die Situation des Aufeinandertreffens dadurch aus, dass sich zwei Parteien gegenüberstünden, von denen eine sowohl hinsichtlich körperlicher Einwirkungen mit „Stichschutzwesten, mit Handschuhen, gegebenenfalls mit Helm, mit Schutzuniform, mit Tasern, mit Schlagstöcken, … sowie noch mit der Waffe“[128] ausgerüstet, als auch in ihrer Gewaltanwendungskompetenz besonders geschult seien. Zudem liege der Eskalationsdynamik im Regelfall eine Vorgeschichte zugrunde, bei der ein spürbarer Grundrechtseingriff stattgefunden habe, sodass „Angriffe aus dem Nichts heraus“ nur in einem „marginalen Bereich zu finden sind.“[129] Generell ginge es meist um Handlungen, „die objektiv vollständig ungeeignet wären, den […] Polizeibeamten zu verletzen.“[130]
Trotzdem waren sich die Expert:innen aus der staatsanwaltschaftlichen und strafgerichtlichen Praxis einig, dass Vollzugsbeamt:innen durch die Ausübung ihres Amts einer höheren Gefährdung ausgesetzt seien und dies eine besondere Schutzbedürftigkeit ihrer Rechtsgüter[131] begründe. Ob hierbei ein möglicher Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vorliege, wurde zum großen Teil verneint, da es einen sachlich gerechtfertigten Grund für die Ungleichbehandlung gebe.
„Aber ich würde das jetzt mal im Grundsatz nicht angreifen, dass es eine Art Sonderstrafrecht ist, aber Artikel 3 GG erlaubt halt auch, die Ungleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Und wenn ich sehe, dass, wenn ich als Privatperson über die Straße laufe, bin ich grundsätzlich weniger gefährdet als der Beamte, der Vollstreckungen vorzunehmen hat oder der sich bei einer Diensthandlung befindet. Also ist das überhaupt nicht vergleichbar. Vergleichbarkeit, ist, wenn wir andere Berufe mit hineinnehmen, die auch besonders gefährdet sind. Das halte ich für diskutierbar, aber die Kritik, Beamte werden jetzt da besonders geschützt, das ist ja grad Sinn und Zweck der Sache. Also würde ich die eher zurückweisen.“ (StrafrichterInnen\1606747142-20200625_e_straf_ri: 163)
Demgegenüber sah der Großteil der Expert:innen aus der Strafverteidigung den allgemeinen Gleichheitssatz tangiert. Anders als die Vertreter:innen der Strafrichterschaft und der Staatsanwaltschaft erkannten sie keinen sachlichen Grund, der eine Ungleichbehandlung rechtfertige.
„Haben wir im Grunde ja auch gerade schon kurz drüber gesprochen, also ich finde es schwierig, die Wahl des Opfers quasi mit einer Strafandrohung zu verknüpfen. Das kann aus meiner Sicht nicht sein. Das ist mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht zu vereinbaren.“ (StrafverteidigerInnen\1609934832-20201113_stv-c: 123)
b) Definition des tätlichen Angriffs und typische Angriffshandlungen
Die befragten Expert:innen schilderten übereinstimmend ähnliche Handlungen, die sie als Angriffshandlungen bewerteten. Ein wesentlicher Unterschied bestand jedoch darin, dass die Art der Angriffshandlungen hinsichtlich des polizeilichen Einsatzgeschehens divergierte, je nachdem ob es sich um Einsätze im Streifendienst oder Einsätze handelte, bei denen Kräfte der Bereitschaftspolizei im Rahmen von größeren Einsatzlagen anlässlich von Demonstrationen oder Fußballspielen eingesetzt wurden.
Mit Blick auf Kontexte des Streifendiensts schilderten die Expert:innen, dass tätliche Angriffe „die Handlungen sind, die man normalerweise in der einfachen Körperverletzung wiederfindet, […] das Schlagen in Richtung eines Kollegen, das Werfen mit Gegenständen“,[132] „das blinde Umsichschlagen, Treten und Beißen“[133]. Darüber hinaus wurden auch das „Kratzen“, „Stoßen“, „Kopfstöße“ sowie das „Spucken“ als „Klassiker“ benannt. Häufig seien es Vollstreckungshandlungen, bei denen es zum „Widerstand [u]nd darüber hinaus […] während des Sachverhaltes auch zum tätlichen Angriff [kommt]“.[134]
In Einzelfällen wurden von allen Expert:innenkreisen von tätlichen Angriffen berichtet, die sich aus dem Nichts heraus, d.h. ohne vorherige Interaktion im Sinne einer freiheitsbeschränkenden Maßnahme im Rahmen des Streifendiensts ereigneten und lediglich durch die Anwesenheit der Polizei ausgelöst wurden. Dabei wurde phänomenologisch sowohl auf einzelne (nicht von polizeilichen Maßnahmen betroffene) Personen als auch auf Personengruppen aus polizeilich markierten „Problemvierteln“ Bezug genommen. In diesem Zusammenhang sowie bei Geschehen, die sich in größeren Einsatzlagen ereigneten, berichteten Polizeibeamt:innen ebenfalls von Flaschen- oder Steinwürfen aus der Menge heraus. Ein:e Polizeibeamt:in erzählt auch von einem „Fallenstellen“ in Problembezirken.
„Und wir haben das sogenannte Fallenstellen auch in unseren Problembereichen. Es wird die Polizei angerufen oder wird irgendwie eine Mülltonne angezündet. Die Polizei kommt hin, dann werden entsprechende Drähte gespannt, haben wir gesehen, um die Polizei bewusst und gewollt in eine Falle zu locken. Und wenn sie dann über den Draht stolpern, hat man sich versteckt und bewirft die dann mit Steinen.“ (PolizeibeamtInnen\1609940196-20200715_e_pol_a: 83)
Rein rechtlich wird als tätlicher Angriff die unmittelbar auf den Körper zielende feindselige Einwirkung verstanden, ohne dass diese zum Eintritt eines Körperverletzungserfolgs geführt haben muss.[135] Die Herauslösung des tätlichen Angriffs aus § 113 StGB a.F. und seiner Überführung in einen selbstständigen Straftatbestand unter Erhöhung des Strafrahmens, macht eine genaue Abgrenzung zu den Tatbestandsvarianten des § 113 Abs. 1 StGB erforderlich, da große inhaltliche Kongruenzen bestehen. Anknüpfend an die inhaltlichen Überschneidungen stellt sich deshalb die Frage, inwieweit die bisherige weite Definition des tätlichen Angriffs nach der signifikanten Strafrahmenerhöhung weiterhin Geltung beanspruchen kann.[136] Diese Abgrenzungsproblematik wurde ebenfalls mit den Expert:innen diskutiert.
Ein wesentliches Kriterium, auf das die Expert:innen der Polizei Bezug nahmen, war die Praktikabilität, die positiv hervorgehoben wurde und sich insbesondere auf das Nichterfordernis eines Körperverletzungs- oder Schädigungsvorsatzes bezog. Hieraus wurde abgeleitet, dass die polizeipraktische Arbeit im Vergleich zu den allgemeinen Körperverletzungsdelikten dahingehend „vereinfacht“[137] wurde, das subjektive Absichten oder Motive nicht nachgewiesen werden müssen. Hinsichtlich der Auslegung wiesen jedoch in Abweichung zur weiten Definition einige Polizeibeamt:innen darauf hin, dass Handlungen, die als tätliche Angriffe eingeordnet werden, insbesondere mit Blick auf die Strafandrohung von mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe eine gewisse Erheblichkeit bzw. Intensität hinsichtlich der Gewaltanwendung aufweisen müssten.
„Also tätliche Angriffe werden bei uns so definiert, dass zumindest einmal vom Beschuldigten oder vom Täter eine Verletzungsabsicht unterstellt werden muss. Also nur Umsichschlagen oder leichte Schläge reichen da nicht aus. Wir definieren das so, zumindest einmal liegt mir das so vor, dass es sich beim tätlichen Angriff um eine unmittelbar auf den Körper zielende feindselige Handlung handeln muss, die in der konkreten Situation körperverletzungsgeeignet ist.“ (PolizeibeamtInnen\1609940195-20200709_e_pol_b: 83)
Im Übrigen wurde die Definition von allen Interviewpartner:innen als problematisch angesehen und als „unbestimmt“[138] oder „absurd weit“[139] bezeichnet. Teilweise bestand daher die Forderung nach einer klaren Definition des Begriffs.
„Diese Abgrenzung ist in der Praxis äußerst schwer und fast schon willkürlich. Ich begrüße das ausdrücklich, ich halte es für richtig, dass es hier eine Verschärfung gibt, wenn proaktiv beziehungsweise aktiv gegen Hoheitsträger agiert wird, die Abgrenzung ist aber teilweise schon willkürlich. Ich sage mal, ist einer kuschelig und gibt ein Geständnis, dann springt man auf einen 113. Muss man das Bein steifhalten, kann man mit ein bisschen Auslegung auch einen 114 draus machen. Ich finde, also in der Praxis ist diese Abgrenzung teilweise, klar es gibt eindeutige Fälle, aber es gibt eine breite Grauzone, wo sie willkürlich vorgenommen werden kann. Hier wäre sicherlich eine Verschärfung, nein, eine Klarstellung hilfreich.“ (StaatsanwältInnen\1612266490-20200804_e_sta: 39)
Im Hinblick auf den vorgegebenen Strafrahmen wurde insbesondere eine Einordnung niederschwelliger Handlungen unter den tätlichen Angriff gerade von Expert:innen aus der Strafverteidigung als unverhältnismäßig empfunden.
c) Der Einfluss der Gesetzesänderung auf die Beweiswürdigung
Gegenstand weiterer Untersuchungen bildeten die Auswirkungen auf die Beweiswürdigung, welche mit der Herauslösung des tätlichen Angriffs potenziell einhergehen könnten. Hierauf aufbauend wurde ebenso die Beweissituation vor Gericht beleuchtet.
Die Herauslösung des tätlichen Angriffs aus § 113 StGB a.F. und die Heraufstufung zu einem eigenständigen Straftatbestand warf gleichzeitig die Frage auf, inwieweit die Definitionsmacht der Polizei die Objektivität und schließlich die Beweislage beeinflusst.
Der Begriff der Definitionsmacht geht in Anlehnung an Feest, welcher den Begriff in Deutschland prägte, auf die soziologisch verbreitete Grundannahme zurück, dass jedes Verhalten von der jeweiligen Situationsdefinition abhängig ist und verbindet diese mit dem Begriff der Macht. Gleichzeitig greift dieser Begriff auf die Theorie des Labeling Approach zurück, wonach es sich bei Identifizierung von Straftäter:innen um einen Definitionsprozess handelt.[140]
Handlungen, die sich gegen Vollstreckungsbeamt:innen richten, unterliegen oftmals ihrer subjektiven Wahrnehmung über das Geschehen. Die Strafverteidiger:innen beklagten daher, dass die Polizei demnach nicht nur durch ihre Eigenschaft als Strafverfolgungsbehörde, sondern auch durch den subjektiven Einfluss in Bezug zur Einschätzung einer möglichen Gefahrenlage über eine Definitionsmacht verfüge. Dies führe über die eigene wahrgenommene Schutzbedürftigkeit der Polizei hinaus zu einer Zuschreibung eines höheren Stellenwertes im Vergleich zum bürgerlichen Gegenüber.
„Also die ohnehin vorhandene Definitionsmacht und der Vertrauensvorschuss von Polizeizeugen und Berufszeugen vor Gericht wird durch diese Norm, ja, in dem Bereich tatsächlich so bis ins Unendliche gesteigert.“ (StrafverteidigerInnen\1609934832-20201113_stv-c: 121)
In der Staatsanwaltschaft und Richterschaft wurde vereinzelt von einer falschen Einordnung der Sachverhalte in die geltenden Straftatbestände durch die Polizeibeamt:innen gesprochen. Da die rechtliche Prüfung ohnehin im Verantwortungsbereich der Staatsanwaltschaften und Strafgerichte liegt, wirke sich die Definitionsmacht der Polizei nach überwiegender Auffassung der Expert:innen jedoch nicht auf das weitere Verfahren aus.
„Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht als Problem. Ich bin auch, als ich Staatsanwalt war, nicht im Ansatz gebunden an die Rechtsauffassung der Polizei und habe die auch oft genug nicht geteilt. Die Polizei hat mir das Tatverhalten zu schildern mit zeugenschaftlichen Äußerungen dazu und ich subsumiere selber, ob ich das als 113, 114 gesehen habe. Ich habe mich nie danach gerichtet, was jetzt im Schlussbericht stand als Delikt.“ (StrafrichterInnen\20200716_e_strafri: 119)
Das Verfahren selbst ist aber gerade in Widerstandssachen vom Zeugenbeweis geprägt. In seltenen Fällen stehen dem Gericht außerdem Fotografien oder Videoaufnahmen als Augenscheinsbeweise zur Verfügung. Die wichtigsten Zeugen sind die Vollstreckungsbeamt:innen oder ihnen Gleichgestellte selbst. Daraus resultiert ein Konflikt, da die Hauptbelastungszeug:innen zugleich Geschädigte und in der Regel auch Anzeigeerstatter:innen sind. Die Zuständigkeit und Vorgehensweise in Bezug auf die Anzeigeerstattung und Sachbearbeitung von Widerstandsdelikten innerhalb der Polizeibehörden unterscheidet sich von Behörde zu Behörde.
„[E]s ist in […] nicht geregelt, ich halte das immer für zumindest kritisch, wenn jemand betroffen ist, verletzt worden ist, dass der dann selber eine Anzeige schreibt. [E]r ist so sehr betroffen von diesem Verhalten, dass er vielleicht etwas aufschreibt, wie soll ich es beschreiben, also gar nicht bewusst, sondern vielleicht irgendwas aufschreibt, was ein Außenstehender nicht so festgestellt hat. Also subjektiv objektiv. Also ich unterrichte, aus meiner Sicht, wenn ein Kollege verletzt worden ist, wäre es für mich zielführend, wenn der Streifenpartner oder andere Kollegen, die dabei gewesen sind, die Anzeige aufnehmen und nicht der Betroffene selber.“ (PolizeibeamtInnen\1609940198-20200715_e_pol_b: 47)
Vertreter:innen der Staatsanwaltschaft schrieben den Zeug:innenaussagen von Vollstreckungsbeamt:innen, als sog. Berufszeugen, einen hohen Stellenwert vor Gericht zu. Die Annahme, dass es sich bei einer polizeilichen Aussage, um eine besonders vertrauenswürdige handele, wurde vor allem auf die dienstliche Stellung und die rechtlichen Folgen einer Falschaussage gestützt, die Beamt:innen stärker treffen als eine Privatperson.
„Ich würde schon sagen, dass natürlich ein Polizeibeamter oder auch ein Vollzugsbeamter oder auch ein Rettungsdienstbeamter als Zeuge schon eine gewisse, vielleicht […], wie soll ich das ausdrücken, eine gewisse Grundannahme dafür bietet, dass er richtig aussagen wird. Allein schon, weil bei diesen Personen, insbesondere bei Polizeibeamten, das Wissen da ist, dass eine Falschaussage erhebliche Konsequenzen hätte, nicht nur strafrechtlich, sondern auch dienstrechtlich, und weil man wie jetzt auch bei Staatsanwälten und bei Richtern davon ausgeht, dass der Grundsatz da ist, dass man sich an alle geltenden Vorschriften hält. Deshalb wurde man ja ein entsprechender Beamter. Also deshalb würde ich schon sagen, dass per se solche Zeugen eine gewisse Glaubwürdigkeit genießen.“ (StaatsanwältInnen\1617116677-21200324_sta_b: 211)
Diese Sonderrolle von Polizeibeamt:innen, wurde gerade von der Strafverteidigung im Hinblick auf die Unschuldsvermutung des:der Angeklagten als problematisch angesehen. Der von der Justiz entgegengebrachte Vertrauensvorschuss erschwere die Verteidigung der Widerstandstäter:innen. Vereinzelt wurde sogar von einer Beweislastumkehr gesprochen.
„Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde […] sogar sagen, […] in diesen Fällen ist es sogar so, dass es faktisch zu einer Beweislastumkehr kommt. Was ich damit sagen will, ist, es gilt ja eigentlich die Unschuldsvermutung.“ (StrafverteidigerInnen\1625052521-21200527_stv: 197)
6. Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf das Gesetz sowie die Gesetzesauslegung
Hinsichtlich eines Nachbesserungsbedarfs wurde eine weitere Strafschärfung von fast allen Interviewpartner:innen abgelehnt bzw. als nicht notwendig erachtet.
Die befragten Polizeibeamt:innen stellten größtenteils darauf ab, dass die Gesetze und der bestehende Strafrahmen zunächst umgesetzt werden sollen. Ein weiterer Reformbedarf würde sich dann anhand der Verurteilungen offenbaren. Ein:e Polizeibeamt:in lehnte eine weitere Anhebung der Mindeststrafe des tätlichen Angriffs aufgrund der Nebenfolgen, die mit einer Verurteilung bzw. Eintragung in das Führungszeugnis einhergehen, ab. Andere Polizeibeamt:innen stellten wiederum den generalpräventiven Charakter eines solchen Gesetzes in Frage.
In der Strafverteidigung wurde eine Anhebung der Mindeststrafe des tätlichen Angriffs auf sechs Monate teilweise abgelehnt, da eine Umwandlung in eine Geldstrafe nach § 47 StGB dadurch unmöglich wird. Im Hinblick auf die Einführung eines weiteren Regelbeispiels, insbesondere für den hinterlistigen Überfall, wurde aufgeworfen, dass es sich hierbei nur um Einzelfälle handele. Auf diese könne man bereits aufgrund der aktuellen Gesetzeslage hinreichend eingehen.
Auch in der Staatsanwaltschaft wurde sich mehrheitlich gegen eine weitere Strafschärfung ausgesprochen. Der bestehende Strafrahmen wurde bereits als „abschreckend genug“[141] betrachtet und eine weitere Strafschärfung als „zu weitgehend“[142] bezeichnet. Es sei möglich, einzelne Tatmodalitäten wie bspw. einen hinterlistigen Überfall anhand der §§ 223, 224 StGB zu würdigen. Nach einem:einer Staatsanwält:in ergäben sich Probleme eher aus praktischer Sicht (Bsp.: fehlerhafte Ermittlung). Ein:e andere:r Staatsanwält:in sah aufgrund der bereits vorhandenen konsequenten Strafverfolgungspraxis das Erfordernis sozialpolitischer Maßnahmen.
Nur vereinzelt sahen Staatsanwält:innen einen Nutzen in einer weiteren Strafschärfung. Dabei wurde jedoch von einem:einer Expert:in die Mindeststrafe herausgenommen und betont, dass eine Anhebung der Höchststrafe eine flexiblere Einzelfallentscheidung ermögliche. Ein:e andere:r Staatsanwält:in stellte wiederum darauf ab, dass er:sie eine Verschärfung im Hinblick auf Regelbeispiele sinnig finde, er:sie aber nicht die Notwendigkeit einer Erhöhung der Mindeststrafe in Bezug auf den tätlichen Angriff sehe.
Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass die Mindeststrafe und der aktuelle Strafrahmen mehrheitlich als ausreichend erachtet wurden. Zur Verbesserung des Schutzes von Vollstreckungsbeamt:innen und ihnen Gleichgestellten wurden von den Expert:innen größtenteils Maßnahmen auf anderer Ebene gefordert. Gerade eine Anhebung der Mindeststrafe beim tätlichen Angriff wurde als zu unflexibel angesehen.
In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird zum Teil eine Erheblichkeitsschwelle als einschränkendes Korrektiv für die weite Definition des tätlichen Angriffs gefordert.[143] Zur Möglichkeit einer solchen restriktiven Auslegung wurden die Jurist:innen befragt.
Während sich bei den Strafverteidiger:innen lediglich ein:e Expert:in gegen die Einführung einer Erheblichkeitsschwelle aussprach, ergab sich aus der Befragung der Staatsanwält:innen und Richter:innen ein eher heterogenes Bild. Befürworter:innen sahen in einer restriktiven Auslegung des Merkmals die Möglichkeit, adäquat auf niederschwellige Tathandlungen zu reagieren und wandten diese teilweise bereits an. Dabei wurde zum Teil auf den Körperverletzungserfolg oder den Körperverletzungsvorsatz als Kriterium abgestellt.
Kritiker:innen hingegen stützten ihre Argumentation häufig darauf, dass sich aus einer restriktiven Auslegung lediglich ein weiteres „Definitionsproblem“[144] ergebe, da der Begriff der Erheblichkeit ebenfalls zu unbestimmt sei. Teilweise verwiesen sie auf die fehlende Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung, indem bspw. eine Einstellung aus Opportunitätsgründen in solchen Fällen bereits Abhilfe verschaffen könne. Andere wiederum sahen darin eine bewusste gesetzgeberische Entscheidung, dass „nicht eine körperliche Tat […] stattgefunden haben [muss und] eine Krafteinwirkung […] im Vorstadium [aus]reicht […].“[145]
Während die Jurist:innen explizit nach einer Einschätzung zur Notwendigkeit eines minderschweren Falls im Hinblick auf den tätlichen Angriff befragt wurden, enthielt der Fragebogen der Polizeibeamt:innen lediglich die Frage nach Nachbesserungsvorschlägen im Hinblick auf die Gesetzesänderung. Im Rahmen dessen äußerten zwei Polizeibeamt:innen die Einführung eines minderschweren Falls für niederschwellige Handlungen. In Bezug auf solche Tathandlungen empfanden sie die Androhung einer Freiheitsstrafe als nicht sachgerecht.
Der Befragung der Staatsanwaltschaft ließ sich keine eindeutige Tendenz entnehmen. Etwa die Hälfte der Staatsanwält:innen sah die Notwendigkeit der Einführung eines minderschweren Falls. Sie begründeten diese anhand der weiten Auslegung des tätlichen Angriffs und des daraus resultierenden Erfordernisses eines einschränkenden Korrektivs, um eine gerechtere Entscheidung im Einzelfall zu ermöglichen.
„Also ich finde prinzipiell die erhöhte Strafandrohung von den drei Monaten richtig, mir fehlt nur einfach die Möglichkeit über einen minder schweren Fall auch mal in konkreten Verfahren, wo es angezeigt ist, davon absehen zu können. Also ich meine, wenn da eine massive Alkoholisierung im Spiel ist, kann ich natürlich schon über den § 21 StGB dann mildern und mir sagen, okay, das wäre jetzt im Vergleich auch zu anderen Personen, die jetzt keine Vollstreckungsbeamten sind [und tätlich angegriffen werden], angemessen. Aber dieser tätliche Angriff ist ja sehr, sehr weit gefasst vom Tatbestand und dann eben die drei Monate oder neunzig Tagessätze als Mindeststrafe, ohne Möglichkeiten davon runterzukommen, da fehlt mir oft was, das finde ich oftmals nicht im Verhältnis richtig und angemessen.“ (StaatsanwältInnen\1617116676-21200325_sta: 93)
In diesem Zusammenhang schilderte ein:e Staatsanwält:in, dass sich der Anwendungsbereich des tätlichen Angriffs in der Rechtsanwendungspraxis anders (weiter) darstelle, als es vom Gesetzgeber bei der Einführung des § 114 StGB gedacht war.
Die sich gegen die Notwendigkeit eines minderschweren Falls aussprechende Hälfte der Staatsanwält:innen stützte ihre Argumentation auf die bereits bestehenden Möglichkeiten des StGB und der StPO, adäquat auf Einzelfälle zu reagieren. Dabei wurden beispielhaft die Umwandlung in eine Geldstrafe nach § 47 StGB, die Regelungen zur Schuldfähigkeit nach den §§ 20, 21 StGB sowie die Einstellung nach den §§ 153 ff. StPO herangezogen. Zwei Expert:innen sahen die Notwendigkeit eines minderschweren Falls gegeben, wenn das Strafmaß des tätlichen Angriffs höher wäre. Dabei zog ein:e Expertin den Vergleich zu anderen gesetzlich normierten minderschweren Fällen und argumentierte, dass der Grundtatbestand dort regelmäßig eine Mindeststrafe von sechs Monaten oder einem Jahr androhe. Ein:e weiterer Expert:in sah die Notwendigkeit eines minderschweren Falls gegeben, wenn die §§ 113 ff. StGB keine Regelbeispiele aufwiesen. Ein:e an-dere:r gab zu bedenken, dass man im Rahmen eines potenziellen minderschweren Falles wieder auf den ursprünglichen Strafrahmen des § 113 StGB zurückfalle.
Der Großteil der Richter:innen hingegen empfand die Einführung eines minderschweren Falles für solche Fälle sinnvoll, in denen der Unrechtsgehalt als gering bzw. die Tat als weniger verwerflich angesehen werde. Teilweise betonten sie, dass ein einschränkendes Korrektiv aufgrund der Möglichkeiten des StGB und der StPO zwar nicht notwendig, aber sinnvoll sei. Auf der Grundlage des gleichen Arguments lehnten andere die Erforderlichkeit eines minderschweren Falls ab.
Nahezu ausnahmslos erachteten die Strafverteidiger:innen die Einführung eines minderschweren Falles für erforderlich. Zeitgleich plädierte die Hälfte von ihnen für die Abschaffung des § 114 StGB. Da sie dies jedoch für unrealistisch befanden, forderten sie zumindest einen minderschweren Fall als Korrektiv für atypische Fälle. Dessen Einführung wurde vor dem Hintergrund der eigentlichen Forderung, nämlich der Abschaffung des § 114 StGB, in einigen Interviews als „Alibidiskussion“[146] oder „Scheinkompromiss“[147] bezeichnet. Nur in einem Fall lehnte ein:e Strafverteidiger:in den minderschweren Fall mit dem Verweis auf andere Strafmilderungsmöglichkeiten (bspw. § 49 StGB) ab.
VI. Strafjustizielle Folgen der Gesetzesreform
1. Strafmaß Verfahrensaktenanalyse – Verurteilungen
Hinsichtlich der Überführung der Tatbegehungsform des tätlichen Angriffs unter Verzicht auf das Merkmal der Vollstreckungshandlung bei gleichzeitiger Erhöhung des Strafrahmens war zu vermuten, dass aufgrund des erhöhten Mindeststrafmaßes seit der Gesetzesreform höhere Strafen ausgeurteilt werden. Dem wurde im Rahmen der Verfahrensaktenanalyse und den Expert:inneninterviews nachgegangen.
a) Rechtsfolgen
Von den 120 Akten zu Verurteilungen endeten 83 Verfahren mit einem Urteil. Der deutlich geringere Anteil der Entscheidungen (n=37) erging im Wege eines Strafbefehlsverfahrens. Dabei ist hinsichtlich der Aussagekraft dieser Angaben anzumerken, dass in den meisten Verfahren weitere Straftaten (insbesondere Beleidigungen und Körperverletzungsdelikte) mitverwirklicht und/oder Verfahren miteinander verbunden wurden.[148] Es lässt sich somit nicht unmittelbar aus der Anzahl der verwirklichten Widerstandsdelikte und der Anzahl der Entscheidungen bzw. Sanktionen ein Zusammenhang ableiten.
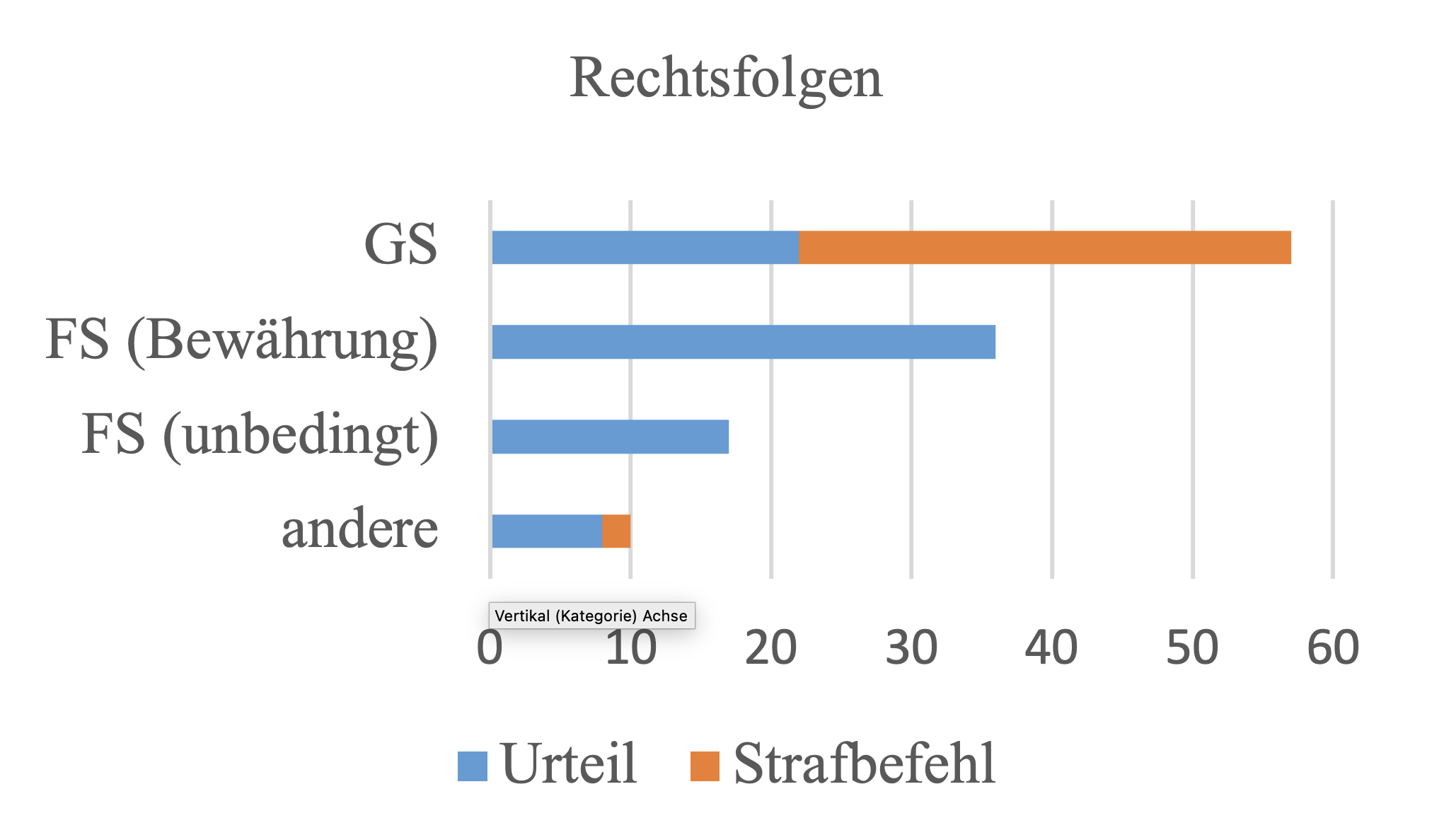
Abbildung 3: Art der Entscheidung
Betrachtet man die verhängten Rechtsfolgen in ihrer Gesamtheit (Strafbefehle und Urteile), so wurde in den meisten Fällen eine Geldstrafe auferlegt. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die Urteile isoliert in den Blick nimmt. Hier wurde in den meisten Fällen eine Freiheitsstrafe ausgeurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung (Bewährungsstrafe) ausgesetzt wurde (n=36). Gegen 22 Angeklagte wurde eine Geldstrafe verhängt. In ca. 20 % (n=17) aller Verfahren, die mit einem Urteil endeten, wurde eine unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen. Bei den Strafbefehlsverfahren (n=37) fiel die Verteilung der festgesetzten Sanktionen schon wegen gesetzlicher Vorgaben[149] anders aus. Die mit Abstand am häufigsten festgesetzte Rechtsfolge war die Geldstrafe (n=35). In zwei Fällen kam § 59 StGB (Verwarnung mit Strafvorbehalt) zur Anwendung. Unter den Akten befanden sich 6 Jugendverfahren bei denen Weisungen, Auflagen und Jugendarrest verhangen wurden. In drei Fällen wurde eine Verwarnung ausgesprochen.
In insgesamt zwölf Strafverfahren wurden zugleich in einem Adhäsionsverfahren oder im Anschluss an das Verfahren zivilrechtliche Ansprüche der Verletzten geltend gemacht bzw. sind Zahlungen bereits vor Eröffnung der Hauptverhandlung erfolgt. Die Beträge lagen hierbei in acht Fällen zwischen 200 EUR und 500 EUR. In einem Fall wurde vor der Berufungsverhandlung ein Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt, in dem eine Schmerzensgeldzahlung i.H.v. 1.500 EUR veranlasst wurde. Zwei Adhäsionsbeklagte wurden zu einer Schmerzensgeldzahlung i.H.v. 5.000 EUR bzw. 9.000 EUR verurteilt. In einem Fall wurde ein Vergleich über die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 50.000 EUR geschlossen. Die Höhe der Forderung in diesem Fall übertraf deutlich die der übrigen, zugleich aber auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der:des Angeklagten.
b) Entwicklungstendenzen
Die Analyse der Interaktionsdynamiken hat aufgezeigt, dass sich die Sachverhalte, bei denen sich Widerstandsdelikte ereignen, vor und nach der Gesetzesreform kaum unterscheiden. Dem „erhöhten Gefährdungspotential“ – wie es im Gesetzentwurf heißt[150] – kann somit durch die Änderung der §§ 113 ff. StGB nicht begegnet werden.
Bei einem Vergleich der Fälle vor (n=46) und nach der Reform (n=74) zeigte sich in der Analyse, dass es insgesamt eine abnehmende Tendenz schwerer Strafen gibt. Am deutlichsten zeigte sich dies bei den unbedingten Freiheitsstrafen. Während diese Sanktionsform in den untersuchten Fällen vor der Reform in ca. 17 % aller Fälle verhängt wurde, wurden nach der Reform nur noch 8 % aller Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Die durchschnittliche Dauer der Freiheitsstrafen betrug zwar vor der Reform mit acht Monaten deutlich weniger als nach der Reform, wo im Durchschnitt eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten verhängt wurde. Die deutlich höheren Freiheitsstrafen, die nach der Reform verhängt wurden, sind jedoch auf die besonders schweren Fälle zurückzuführen. Nimmt man diese heraus, zeigt sich sogar ein leichter Rückgang in der Dauer der verhängten Freiheitsstrafen. Diese betrugen im Durchschnitt nur fünf Monate nach der Reform; vor der Reform lag die durchschnittliche Dauer mit etwa fünfeinhalb Monaten etwas höher. Unter den besonders schweren Fällen nach der Reform spielte dabei in einem Fall die Verwendungsabsicht (die nicht mehr erforderlich war) eine entscheidende Rolle für die Verurteilung. Hier wurde nach der Festnahme ein Klappmesser in der Tasche der beschuldigten Person gefunden. In der Mehrheit der Fälle, in denen der Tatbestand des § 113 Abs. 2 bzw. § 114 Abs. 2 StGB verwirklicht wurde, kam es hingegen zum Einsatz des gefährlichen Werkzeuges oder der Waffe bzw. wurde die Einsatzkraft in Todesgefahr gebracht.
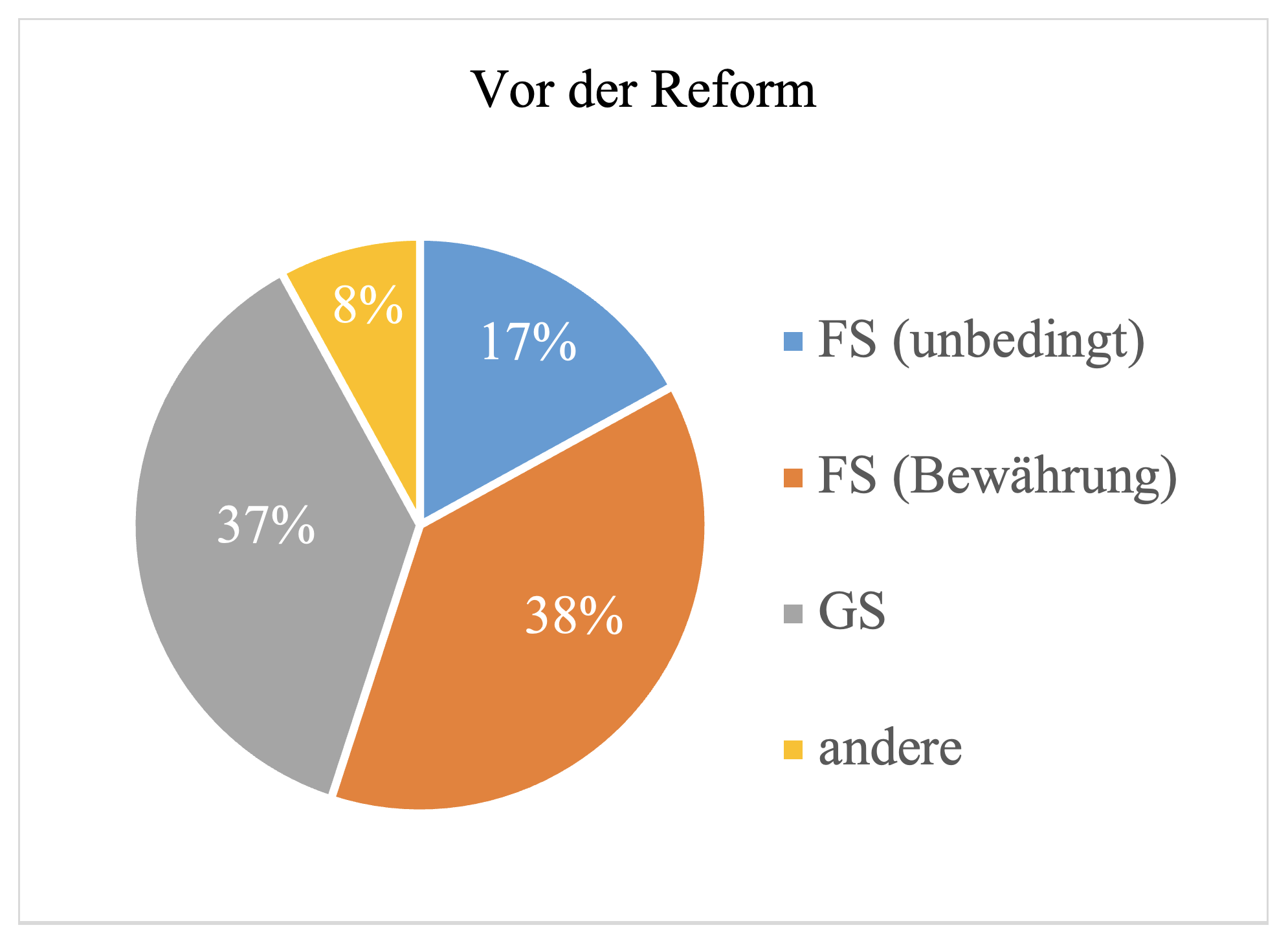
Abbildung 4: Art der Entscheidung vor der Reform
Ein leichter Rückgang verzeichnet sich auch bei den Bewährungsstrafen. So wurde in nur noch etwa einem Drittel aller Fälle, die sich nach der Gesetzesänderung ereigneten, eine Bewährungsstrafe verhängt. In den ausgewerteten Fällen vor der Reform lag diese Sanktionsform noch bei 38 %. Weisungen gemäß § 56c StGB wurden insbesondere in Form von Alkoholentziehungskuren und Drogenscreenings, Beratungs- oder Sprachkursen vor und nach der Reform erteilt. Vergleicht man die Auflagen gemäß § 56b StGB zeigt sich hier nur eine marginale Erhöhung der auferlegten Geldbeträge. In den Fällen nach der Reform lagen die Geldbeträge, die den Verurteilten auferlegt wurden, im Durchschnitt bei 570 EUR, vor der Reform lagen diese bei 500 EUR. Ein Rückgang verzeichnet sich hingegen bei der Dauer der Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Diese betrug vor der Reform im Durchschnitt mit zehn Monaten (3 Monate bis 24 Monate) etwa drei Monate mehr als in den Fällen nach der Reform (3 Monate bis 14 Monate). Interessanterweise sind die festgesetzten Strafen, die nach der Reform zur Bewährung ausgesetzt wurden mit sieben Monaten im Durchschnitt höher als die nach der Gesetzesänderung ausgeurteilten unbedingten Freiheitsstrafen, die (ohne die besonders schweren Fälle) nur fünf Monate durchschnittlich betrugen. Ein Erklärungsansatz dafür, dass trotz geringerer Freiheitsstrafen keine Bewährungsstrafen verhängt wurden, kann darin liegen, dass durch die verbundenen Verfahren die Voraussetzungen des § 56 StGB nicht vorlagen.
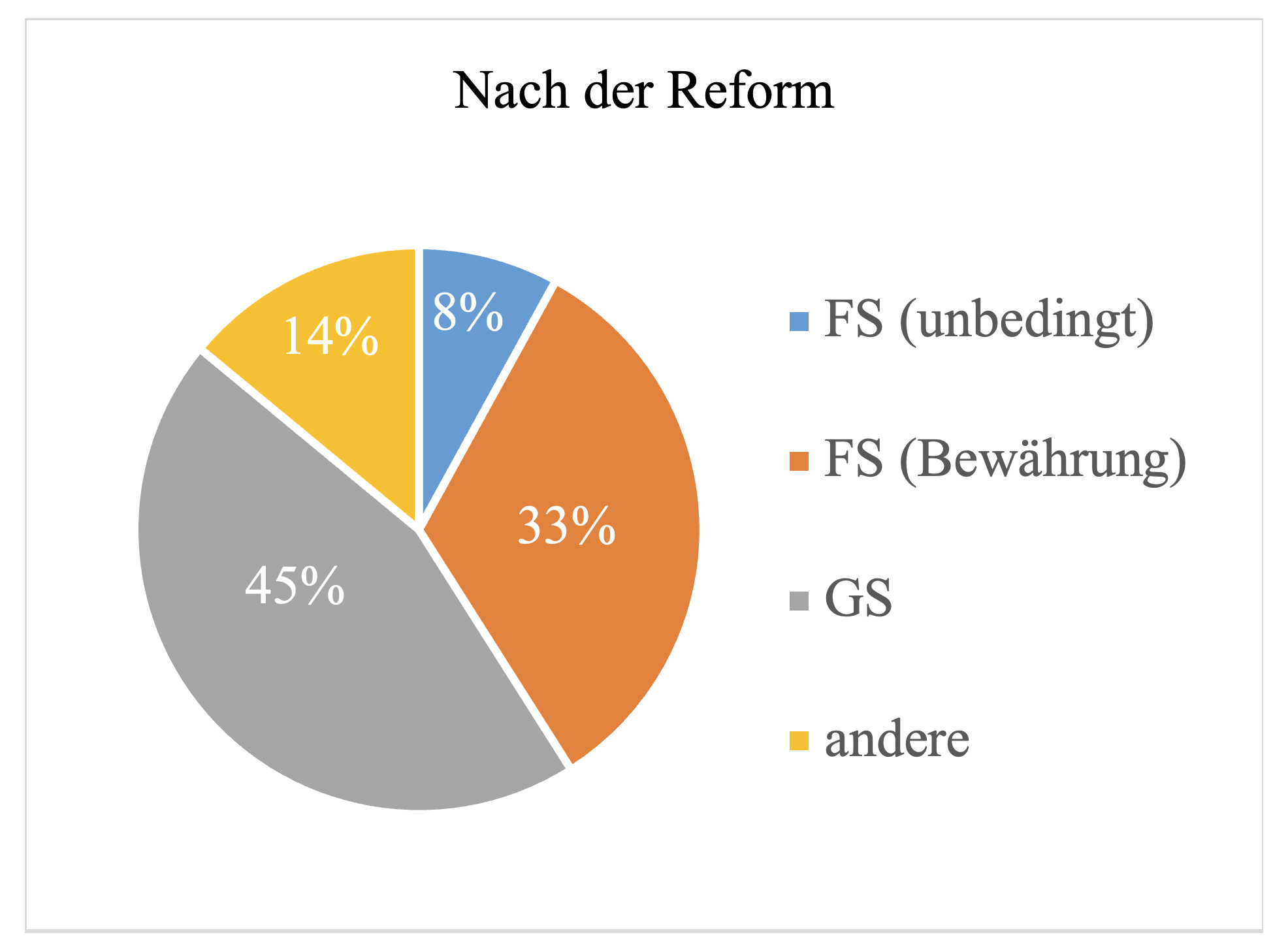
Abbildung 5: Art der Entscheidung nach der Reform
Der Rückgang unbedingter und bedingter Freiheitsstrafen hat zur Folge, dass deutlich mehr Geldstrafen ausgeurteilt wurden. Ein deutlicher Anstieg ist vor allem im Bereich der Geldstrafen festzustellen, die im Wege eines Strafbefehlsverfahrens festgesetzt wurden. Von allen der Auswertung zugrunde liegenden Akten, in denen Geldstrafen nach dem 30.5.2017 ergingen, waren 63 % durch ein Strafbefehlsverfahren festgesetzt. In der Vergleichsstichprobe lag dieser Anteil bei nur 42 %. Nahezu verdoppelt hat sich auch der Anteil der in Abbildung 2 als „andere“ bezeichneten Sanktionen. Hierunter wurden die Zuchtmittel (§ 13 Abs. 2 JGG) des Jugendstrafverfahrens und Verwarnungen mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB eingruppiert.
2. Verfahrenseinstellungen und Freisprüche
Hinsichtlich der Verfahrenseinstellungen und Freisprüche soll ein Einblick in die unterschiedlichen Einstellungsgründe gegeben werden. Die Ergebnisse der Verfahrensaktenanalyse wurden um die Erkenntnisse aus den Interviews mit Vertreter:innen aus der Justiz ergänzt. Zudem wurde ein Vergleich mit den Verurteilungen möglich, der einerseits Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Rahmen des strafprozessualen Prozesses identifiziert und anderseits Aufschluss über den Schwellenwert strafbaren Handelns liefert. Des Weiteren wurden Parameter deutlich, die bspw. eine Einstellung unter Auflagen begünstigen.
a) Verfahrensaktenanalyse zu Einstellungen und Freisprüchen
60 Verfahrensakten wurden in Bezug auf die Gründe für eine Verfahrenseinstellung oder einen Freispruch analysiert. Dabei erfolgte die zufällige Auswahl der Verfahren durch die angefragten Staatsanwaltschaften.[151] Kriterien für die Auswahl wurden nicht festgelegt, außer, dass sich die Verfahren bei der jeweiligen Staatsanwaltschaft auf den Zeitraum vor und nach der Gesetzesreform beziehen sollten. Auch Jugendverfahren wurden nicht ausgeschlossen.
aa) Einstellungsgründe
Neben zwei Freisprüchen fand sich in den Verfahrensakten je ein Fall zu einer Einstellung aufgrund eines Verfahrenshindernisses nach § 260 Abs. 3 StPO und nach § 206a StPO[152] sowie ein Fall, der aufgrund eines vorübergehenden Hindernisses gem. § 205 StPO eingestellt wurde. Hier war der:die Angeschuldigte nach Maßgabe des § 276 StPO abwesend.[153] Zweimal kam es zu einer Teileinstellung bei mehreren Taten gem. § 154 Abs. 1, Abs. 2 StPO.[154] Am häufigsten (35 % der Fälle) erfolgte eine Verfahrenseinstellung noch im Ermittlungsverfahren gem. § 170 Abs. 2 StPO, da nicht genügend Anlass zur Erhebung einer öffentlichen Klage bestand. Eine solche Entscheidung kann auf tatsächlichen oder rechtlichen Gründen beruhen, ihr kann jedoch auch eine Ermessensentscheidung zugrunde liegen.[155] Als Hauptgrund (57 %) für die Verfahrenseinstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO wurde eine nicht auszuschließende verminderte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit der Beschuldigten in der staatsanwaltlichen Verfügung genannt. Dabei wurde in einem Fall ein psychiatrisches Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit eingeholt, in drei weiteren Ermittlungsverfahren wurde dies als unverhältnismäßig erachtet, da bereits psychische Erkrankungen seitens der Beschuldigten bekannt waren. In einem Drittel der Fälle war der Tatbestand der §§ 113, 114 StGB – teilweise wegen eines rein passiven Widerstandes – nicht erfüllt, in einem Fall wurde ein Erlaubnistatbestandsirrtum angenommen und in einem weiteren führte der Ablauf der Verjährungsfrist zur Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StGB.
Der zweithäufigste Einstellungsrund (22 %) war ein Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit. So wurde in 8 Verfahren eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft (§ 153 Abs. 1 StPO) vor und in 4 Verfahren eine Einstellung durch das Gericht nach Klageerhebung (§ 153 Abs. 2 StPO) vorgenommen.
Eine Einstellung gem. § 153 StPO setzt voraus, dass kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung eines Vergehens besteht und die Schuld des Täters als gering erachtet werden kann. Die Schuld wird dabei hypothetisch beurteilt, wobei die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet ist, die Sachverhaltsaufklärung bis zu einer vollständigen Entlastung des Beschuldigten fortzuführen.[156] Die Beurteilung der Schuld erfolgt letztlich nach den Maßstäben des § 46 StGB.[157] Dabei muss sie deutlich geringer ausfallen als bei vergleichbaren Vergehen, damit eine Einstellung in Betracht kommt.[158] Daneben darf kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung gegeben sein, d.h. der Rechtsfrieden darf über den Lebenskreis des Verletzten hinaus nicht so weit gestört sein, dass die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit wird und aus spezial- oder generalpräventiven Gründen unabdingbar erscheint.[159] Letzteres wurde durch die Staatsanwaltschaften und die Gerichte meist floskelhaft festgestellt. Hinsichtlich der Schuld gab es auch hier in zwei Dritteln der Fälle Zweifel, überwiegend wegen bestehender psychischer Erkrankungen, aber auch wegen starker Alkoholisierungen und Betäubungsmittelkonsum. Lediglich zweimal wurde ein psychiatrisches Gutachten zur Klärung der Schuldfähigkeit eingeholt, wobei dies erst durch das Gericht nach erfolgtem Einspruch gegen einen Strafbefehl initiiert wurde. In 5 Verfahren wurde aus Verhältnismäßigkeitsgründen auf ein psychiatrisches Gutachten verzichtet. Weiterhin fanden sich in den Einstellungsbeschlüssen und Verfügungen im Einzelfall Begründungen wie die Fragwürdigkeit der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes oder die nicht unerheblichen Verletzungen des:der Beschuldigten. Ebenso wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass nur eine:r der Geschädigten Strafanzeige erstattete oder eine Milderung nach § 49 StGB ohnehin in Betracht käme.
Ähnlich häufig wie die Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit (20 %) konnte in der Aktenanalyse das Absehen von der Verfolgung unter Auflage gem. § 153a StPO verzeichnet werden. In Abgrenzung zur Einstellung wegen Geringfügigkeit kommt die Einstellung unter Auflage dann in Betracht, wenn keine Ahndung der Tat dem öffentlichen Interesse entgegensteht, eine Strafmaßnahme aber nicht notwendig erscheint.[160] Weder die Einstellung nach § 153 StPO noch die Einstellung nach § 153a StPO erfährt eine Eintragung in das Bundeszentralregister, wohingegen die Verurteilung mit Strafaussetzung zur Bewährung und die Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) im Bundeszentralregister einzutragen sind (§ 4 Nr. 1 und Nr. 3, § 12 Abs. 2 BZRG).[161] Für den:die Beschuldigte:n sind letztere demnach deutlich belastender. Liegt ein Vergehen vor, darf die Schwere der Schuld der Einstellung nicht entgegenstehen (§ 153a Abs. 1 S. 1 StPO). Dabei muss der Tatverdacht hinreichend sein und unterliegt hinsichtlich der ermittelten Gesamtumstände einer kursorischen Bewertung.[162] Im Unterschied zu der Einstellung gem. § 153 StPO darf beim Absehen von der Strafverfolgung unter Auflagen und Weisungen ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bestehen, es wird jedoch durch die Erfüllung der Auflage oder Weisung durch den Beschuldigten kompensiert.[163] Dieser muss zudem bereit sein, die Auflagen und Weisungen zu erfüllen (§ 153a Abs. 1 S. 1 StPO). Wie bei § 153 StPO kann die Einstellung auf Initiative der Staatsanwaltschaft oder nach Anklageerhebung durch das Gericht erfolgen.
In den analysierten Verfahrensakten wurden den Beschuldigten in 11 Fällen eine Geldzahlung (§ 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StPO), in einem Fall ein Täter-Opfer-Ausgleich (§ 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 StPO) und in einem weiteren Fall gemeinnützige Arbeit (§ 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StPO) und eine Geldzahlung als Auflage auferlegt. Die Geldzahlungen bewegten sich dabei in einem Rahmen zwischen 200 EUR und 1.400 EUR. In insgesamt 4 Fällen erfolgte eine Einstellung erst in der Hauptverhandlung gem. § 153a Abs. 2 StPO, davon einmal in der Berufungshauptverhandlung und einmal in der Hauptverhandlung nach einem Einspruch in einem Strafbefehlsverfahren. Wurde die Einstellung in den Verfügungen und Beschlüssen näher begründet, wurde hauptsächlich angeführt, dass der Täter für die Zukunft hinreichend gewarnt und nicht vorbestraft sei und die Tat bereue. Ein Mitverschulden der geschädigten Polizeibeamt:innen war in drei Verfahren Inhalt der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Vereinzelt spielte noch eine Alkoholisierung, eine Entschuldigung des:der Beschuldigten bei den Geschädigten und eine Verletzung des:der Beschuldigten selbst eine Rolle.
Neben dem Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit und unter Auflagen und Weisungen, fanden sich insgesamt 6 Jugendsachen unter den Verfahrensakten. Hier erfolgte die Einstellung nach § 45 JGG durch die Staatsanwaltschaft oder § 47 JGG durch den Richter. § 45 JGG bietet für das Einstellungsverfahren ein Stufensystem: eine folgenlose Einstellung (§ 45 Abs. 1 JGG), die Durchführung einer Erziehungsmaßnahme (§ 45 Abs. 2 JGG) und das formlose richterliche Erziehungsverfahren (§ 45 Abs. 3 JGG). Als Erziehungsmaßnahme kommen alle Maßnahmen in Betracht, die geeignet sind, die Einsicht des:der Jugendlichen in das Unrecht und die Folgen der Tat zu fördern.[164] Das richterliche Erziehungsverfahren findet seine Anwendung in den Fällen, in denen die Jugendstaatsanwältin bzw. der Jugendstaatsanwalt die Erhebung der Klage für nicht erforderlich hält, der:die Jugendliche geständig ist, gleichwohl aber das Einschreiten des:der Jugendrichter:in aus erzieherischen Gründen geboten erscheint. Mögliche Rechtsfolgen werden in § 45 Abs. 3 S. 1 JGG abschließend aufgezählt (Ermahnungen, Weisungen nach § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 4, 7 oder Nr. 9 JGG, Auflagen). Ab dem Zeitpunkt der Anklageerhebung richtet sich die Verfahrenseinstellung nach § 47 JGG. Das Jugendgericht kann nun selbst prüfen, ob und welche Variante die Verfahrenseinstellung zur Anwendung kommen soll. Die Möglichkeiten bleiben dabei gleich (§ 47 Abs. 1 JGG). Während die Einstellung nach § 153 StPO oder § 153a StPO nicht in das Bundeszentralregister eingetragen wird, wird eine gleich gelagerte Verfahrenseinstellung nach dem Jugendstrafrecht gem. § 60 Abs. 1 Nr. 7 BZRG in das Erziehungsregister eingetragen.[165] Den analysierten Verfahrensakten lagen zwei folgenlose Verfahrenseinstellungen gem. § 45 Abs. 1 JGG zugrunde, in denen die Verfehlungen als geringfügig angesehen wurden.
In einem Fall hielt die Staatsanwaltschaft trotz Entschuldigungsschreiben des:der Beschuldigten eine erzieherische Maßnahme (§ 45 Abs. 2 JGG) für erforderlich. Nach Anklageerhebung machte der:die Jugendrichter:in in drei Verfahren von einer Auflagenerteilung Gebrauch (§§ 47 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 45 Abs. 3 S. 1 JGG). Diese erstreckte sich zweimal in der Anordnung gemeinnütziger Arbeit, einmal zeitgleich mit einem Drogenberatungskurs und einmal in der Anordnung einer Geldzahlung in Höhe von 150 EUR an einen gemeinnützigen Verein, gekoppelt mit einer Ermahnung. Alle drei Beschuldigte haben sich in der Hauptverhandlung bei den Geschädigten entschuldigt oder übersandten bereits im Vorfeld ein Entschuldigungsschreiben.
Trotz der definierten Suche nach Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen, übersandten die angefragten Staatsanwaltschaften nach dem Zufallsprinzip lediglich zwei Verfahrensakten, die einen Freispruch zum Inhalt hatten. Die Verfahren ähnelten sich insoweit, als dass beide Angeklagte schuldunfähig (§ 20 StGB) waren und in beiden Fällen ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit eingeholt wurde. In einem Fall stand gutachterlich zusätzlich die Frage nach einer Unterbringung im Maßregelvollzug oder einer Entziehungsanstalt im Raum, wurde aber verneint. Dabei wurden in keinem Fall Opfer körperlich oder seelisch geschädigt oder erheblich gefährdet. Der Freispruch erging einmal in der Hauptverhandlung nach einem Einspruch gegen einen Strafbefehl, in dem anderen Verfahren lagen insgesamt 6 Tathandlungen zugrunde, darunter drei Widerstandshandlungen.
bb) Entwicklungstendenzen
Innerhalb der Jugendverfahren blieb die Anzahl der Verfahrenseinstellungen konstant. Die spezielleren Einstellungsgründe der §§ 205, 206a und 260 Abs. 3 StPO sind hinsichtlich einer Entwicklungstendenz nicht aussagekräftig, da jeweils nur ein Verfahren vorlag. Ähnliches gilt für die Teileinstellung bei mehreren Taten (§ 154 StPO), hier wurde jeweils ein Verfahren vor und eines nach der Gesetzesreform eingestellt.
Die Anzahl der Verfahrenseinstellungen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gem. § 170 Abs. 2 StPO war achtmal vor und dreizehnmal nach der Gesetzesreform zu finden. Dabei wurde in 25 % der Fälle vor der Reform und in 39 % der Fälle nach der Reform eine Einstellung vorgenommen, weil der Tatbestand der §§ 113, 114 StGB nicht erfüllt wurde. Möge man auf Basis der geringen Fallzahl der Verfahrenseinstellungen gem. § 170 Abs. 2 StPO nach einem Erklärungsansatz suchen, so könnte dies mit einem veränderten Anzeigeverhalten der Einsatzkräfte nach der Gesetzesreform zusammenhängen.
Die Verfahrensaktenanalyse der 26 Verfahren, die sich vor und der 34 Verfahren, die sich nach der Gesetzesreform ereigneten, zeigt beim Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) eine Zunahme von 28 %.
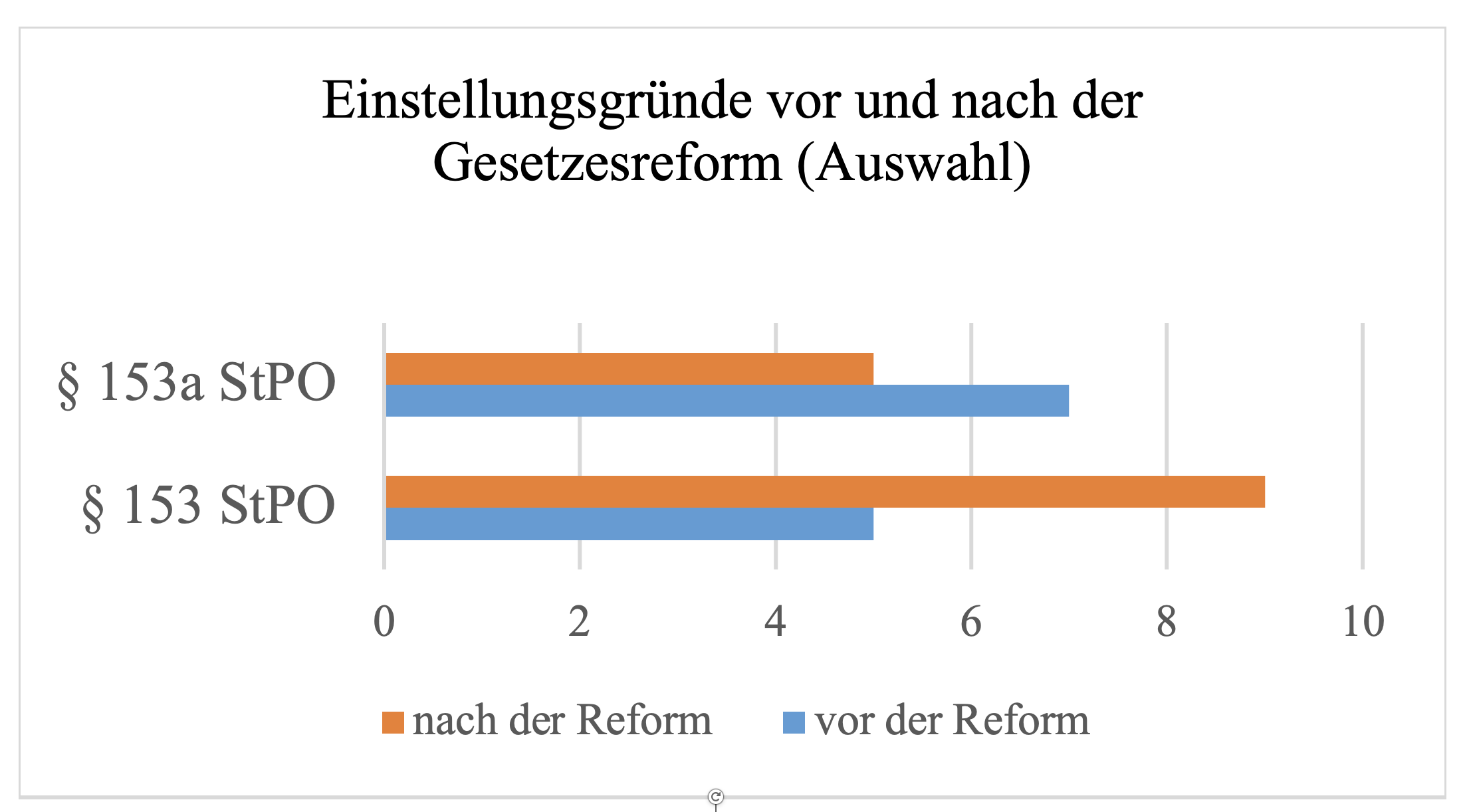
Abbildung 6: Häufigkeit der Opportunitätseinstellungen vor und nach der Reform
Die Gründe für die Verfahrenseinstellungen waren in etwa gleich. Hauptgrund war in allen Ermittlungsverfahren eine in Frage stehende (verminderte) Schuldfähigkeit. Auf die Einholung eines Gutachtens wurde vor sowie nach der Gesetzesreform aus Verhältnismäßigkeitsgründen verzichtet. Lediglich nach der Gesetzesreform fand sich in drei Fällen in der Einstellungsbegründung das Argument, dass ein rein passiver Widerstand vorgelegen habe bzw., dass die Widerstandshandlung im unteren Bereich liege.
Bei der Verfahrenseinstellung unter Auflagen und Weisungen gem. § 153a StPO kehrt sich das Bild um. Hier schrumpften die Fälle nach der Reform um 16 %. Fraglich ist, welche Umstände für diesen Rückgang verantwortlich sein könnten. Der Entscheidung um § 153a StPO liegt immer eine Abwägung zwischen dem Absehen von der Strafverfolgung und der strikten Verfolgung kleinerer Kriminalität zugrunde. Zu fragen ist stets, was die Beantragung eines Strafbefehls mit geringer Geldstrafe (15-20 Tagessätze) oder eine Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) entbehrlich macht. Aus den Einstellungsverfügungen und -beschlüssen lassen sich keine Schlüsse ziehen, warum die ein oder andere Abwägungsentscheidung entsprechend getroffen wurde. Hinsichtlich der Art und Höhe der Auflagen konnten keine nennenswerten Unterschiede im Verhältnis zu vor und nach der Gesetzesreform ausfindig gemacht werden. Als Weisung wurde lediglich von einem Täter-Opfer-Ausgleich und gemeinnütziger Arbeit (dort in Kombination mit einer Geldauflage) Gebrauch gemacht. Der Durchschnittswert der Geldauflagen lag vor der Gesetzesreform bei 357 EUR und nach der Reform bei 480 EUR. Niedrigere Beträge im Bereich von 200 – 300 EUR waren häufiger vor der Reform zu finden.
b) Expert:inneninterviews
Auch mit den Expert:innen aus der Justiz wurden die Einstellungsmöglichkeiten aus Opportunitätsgründen diskutiert:
„Es hat […] auch Bedeutung für die Frage der Verfahrensbearbeitung, insbesondere der Staatsanwaltschaft Stichwort Opportunitätseinstellung nach §§ 153 oder 153a StPO. Unabhängig davon, dass wir natürlich [vor der Gesetzesänderung] auch bei Widerständen gegen Vollstreckungsbeamt:innen nach § 113 StGB, diese Norm eigentlich so gut wie nie angewandt haben, weil wir gesagt haben – und das ist auch meine Auffassung – dass das öffentliche Interesse bei potenziellen Delikten zum Nachteil von Polizeibeamten eigentlich immer gegeben ist. Aber jetzt, wo der § 114 StGB eben in Gesetzesform gegossen ist, mit diesem Mindeststrafrahmen von drei Monaten, da ist die Hemmschwelle natürlich auch für den bearbeitenden Staatsanwalt noch viel höher, zu sagen: „Naja, das ist nur eine geringe Schuld und kein öffentliches Interesse, deswegen stelle ich das Verfahren jetzt nach § 153 StPO ein.“ Aber auch das hätte man natürlich vorher, im Rahmen der Sachbearbeitung nach § 113 StGB, wahrscheinlich ähnlich selten getan.“ (StaatsanwältInnen\1620380329-21200430_sta: 19)
Zunächst fiel auf, dass die Expert:innen der Strafverfolgung berichteten, dass von den Einstellungsmöglichkeiten auch unabhängig von der Herauslösung des tätlichen Angriffs unter gleichzeitig erhöhter Strafandrohung in der Gesamtschau vor der Gesetzesreform sehr restriktiv Gebrauch gemacht wurde bzw. nach wie vor Gebrauch gemacht wird. Dies schien nicht nur für Widerstandsdelikte nach §§ 113 ff. StGB allein, sondern auch im Kontext von Strafverfahren wegen Beleidigung gegenüber Polizeibeamt:innen nach § 185 StGB zu gelten. Die restriktive Einstellungspraxis wurde insbesondere mit der Schutzbedürftigkeit der Personengruppen begründet. In einem Fall wurde betont, dass ein „153er Einstellungsbescheid“ wie ein „Freifahrtschein“ wirke und aufgrund der restriktiven Praxis „der Polizei […] de[r] Rücken“ gestärkt werde.[166] In diesem Kontext ist § 90 Abs. 1 RiStBV wesentlich, wonach die Staatsanwaltschaft vor einer beabsichtigten Einstellung nach §§ 153, 153a und 170 Abs. 2 StPO der Behörde des öffentlichen Rechts, die Strafanzeige erstattet oder die sonst am Ausgang des Verfahrens interessiert ist, die Gründe mitzuteilen hat, die für die Einstellung sprechen und ihr Gelegenheit zur Äußerung zu geben hat. Es kristallisierte sich jedoch heraus, dass sowohl regionale Unterschiede bestehen als auch Unterschiede hinsichtlich der Zuständigkeit, also inwiefern Sonderzuständigkeiten bestehen und Verfahren ggf. in Schwerpunktdezernaten oder Dezernaten für politische Straftaten bearbeitet werden.
Nach Angaben der Expert:innen haben sich in der Praxis unter anderem folgende Fallkonstellationen herausgebildet, die sich weit überwiegend auch in den Ergebnissen der Verfahrensaktenanalyse wiederfinden lassen und in denen eine Einstellung aus Opportunitätsgründen bereits im Ermittlungsverfahren in Frage kommt:
- Sachverhalte, in denen die Schuldfähigkeit der:des Beschuldigten „gerade weil erhöhter Alkoholkonsum oder psychische Erkrankungen doch offensichtlich sind“[167] fraglich ist und aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit auf ein entsprechendes Gutachten verzichtet wird,
- Sachverhalte, bei denen Beschuldigte zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung treten, geständig sind und sich für ihr Verhalten entschuldigt haben,
- Sachverhaltskonstellationen, in denen keine oder geringe Verletzungsfolgen eingetreten sind und der Unrechtsgehalt der Tat als sehr gering eingeschätzt wird (sog. Zappelwiderstände),
- Sachverhaltskonstellationen, bei denen die eingetretenen (Verletzungs)Folgen bei dem:der Beschuldigten nicht unerheblich sind.
Die Herauslösung des tätlichen Angriffs, der mit einer gesetzlichen Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten versehen wurde, führte laut Expert:innen der Staatsanwaltschaft in der Praxis zudem dazu, dass bei jeder Tat, bei der ein tätlicher Angriff Gegenstand ist, die Möglichkeiten zur Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren reduziert wurde. Hinzu komme, dass die Polizei mit Stringenz alle Fälle zur Anzeige bringe, die einen potenziellen Widerstand zum Inhalt haben könnten. Entsprechend sei eine höhere Arbeitsbelastung der Gerichte zu erwarten. Auch die Verteidigungstätigkeit verlagere sich in solchen Verfahren auf die Hauptverhandlung.
„[…] zum Zweiten gibt es auch einen Boomerang. […] Dadurch, dass ersichtlich eingeschränkt Schuldfähige oder Schuldunfähige auch mit Strafanträgen und damit die jeweiligen Bearbeiter mit Strafanzeigen und Verfahren überrollt werden, ist eine sachgerechte Verfolgung der tatsächlichen Fälle nicht mehr möglich. Also hier findet so eine Rückwärtswelle statt, die Polizei versucht in aller Stringenz jeden Fall zur Anzeige zu bringen, auch wenn einer ersichtlich sturzbetrunken war oder kriegstraumatisiert war, […] dann kommt der Strafantrag des Dienstvorgesetzten, wir sind Kraft interner Anweisung gehalten, jedes zu verfolgen. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, eine Einstellung machen will, dann muss ich nach 90 RiStBV anhören und das kommt jedes Mal mit Einwänden zurück. Das heißt, ich erhebe wegen jedem Quark, der nachher ersichtlich wegen §§ 20, 21 StGB entweder freigesprochen wird oder wo dreißig Tagessätze bei rumkommen, Anklage. Ohne, dass man sich jetzt sachgerecht auf die wirklichen Fälle konzentriert. Das ist so, wie soll ich das sagen, also hier tun sich die Ermittlungsbehörden – und damit meine ich jetzt konkret die Polizei – aus einem Schutzwillen heraus keinen Gefallen.“ (StaatsanwältInnen\1612266490-20200804_e_sta: 23)
Die „geringe Einstellungsbereitschaft“[168] wurde gerade auch seitens der Verteidiger:innen als äußerst kritisch betrachtet. Hierbei wurden zwei Ebenen angesprochen, nämlich behördeninterne Arbeitsverfügungen aus rechtsstaatlicher Perspektive sowie die konkreten Auswirkungen der Praxis auf entsprechende Verfahren. Teilweise wurde angeführt, dass diese faktisch die gesetzgeberisch eingeräumten Handlungsmöglichkeiten beschnitten.
„[Es ist] eigentlich total fatal, weil das heißt, man nimmt Staatsanwältinnen und Staatsanwälten – wenn ich die Staatsanwaltschaft als die Behörde sehe, als die der Gesetzgeber sie eigentlich gedacht hat, als neutrale Behörde – dann nimmt man der Staatsanwaltschaft tatsächlich Ermessensentscheidungen der StPO weg. Man nimmt sie ihnen weg. Das heißt, ein Behördenleiter sagt, es interessiert mich nicht, was der Bundesgesetzgeber dir an die Hand gibt als Entscheidungsmöglichkeiten. „Hier ist die Hausverfügung, du hast davon [Gebrauch zu machen]“ und dann kommen […] Hierarchiespiele, dann ist es eine Gerichtssache. Dann muss sich der Staatsanwalt rechtfertigen, dem säuft sowieso das Dezernat ab. Dann muss er noch einen Riesenbericht schreiben. Na ja, natürlich wird er sich dann eher dafür entscheiden, von den Möglichkeiten, die die StPO gibt, keinen Gebrauch zu machen.“ (StrafverteidigerInnen\1625052517-21200611_stv: 67)
Außerdem stieß die Einstellungspraxis bei den Strafverteidiger:innen auf Irritationen vor dem Hintergrund der strafprozessualen Gleichbehandlung von Beschuldigten und der Einzelfallbetrachtung:
„Und das finde ich besonders schwierig, weil das ja auch auf einen Einzelfall überhaupt keine Rücksicht mehr nimmt. Das kann man einfach so pauschal nicht sagen. Wenn jemand mit gerade 21 Jahren in einer hitzigen Situation auf einer Demonstration sich daneben verhält, warum soll das Verfahren gegen [ihn] nicht genauso nach § 153 StPO eingestellt werden können wie [bei] jedem anderen auch, der sich falsch verhalten hat. (StrafverteidigerInnen\1609934832-20201113_stv-c: 53)
3. Verfahrensbegünstigende Faktoren
Nach Meinung der Expert:innen und den Eindrücken aus der Verfahrensaktenanalyse wirkt sich die Gesetzesreform allgemein eher negativ auf die Beschuldigten und ihre Verfahren aus. Somit stellte sich die Frage nach identifizierbaren begünstigenden Faktoren. Hier ist in erster Linie an die Verteidigung zu denken. In den Verfahren der 120 Verurteilungen waren in 58 % (69 Verfahren) die Beschuldigten verteidigt. Die Verteidigung teilte sich auf in 41 Pflichtverteidiger:innen und 28 Wahlverteidiger:innen. Ein Blick in die (wenn vorhandenen) Protokolle der Hauptverhandlungen zeigte, dass sich die Richter:innen teilweise bei der Strafzumessung an die Anträge der Verteidiger:innen annäherten. Ob explizit die Intervention der Verteidigung den Grund dafür geliefert hat, ließ sich aus den Verfahren der Verurteilungen nicht nachvollziehen. Dies gelingt besser anhand der 60 Verfahrenseinstellungen, da hier – wenn die Beschuldigten verteidigt waren – sehr oft eine Anregung zur Einstellung nach § 153 StPO oder § 153a StPO durch die Verteidiger:innen erfolgte.
Bei der Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153 Abs. 1 StPO) waren 64 % der Beschuldigten nicht verteidigt, 22 % ließen sich durch eine:n Wahlverteidiger:in vertreten und 14 % wurde ein:e Pflichtverteidiger:in zur Seite gestellt. Dabei waren deutlich mehr Personen zum Zeitpunkt einer Einstellung nach Anklageerhebung (§ 153 Abs. 2 StPO) verteidigt. In den Fällen der Verfahrenseinstellung unter Auflage und Weisungen waren lediglich 33 % der Beschuldigten nicht verteidigt. 67 % der verteidigten Personen wählten eine:n Wahlverteidiger:in. Eine Pflichtverteidigung gab es nicht. Auch hier lag der prozentuale Anteil der verteidigten Beschuldigten zum Zeitpunkt nach Anklageerhebung höher (25 % zu 38 %).
Im Vergleich zu einer Verurteilung, wirkt sich gerade die Verfahrenseinstellung gem. §§ 153 und 153a StPO für den Beschuldigten deutlich günstiger aus. Weil die Schuld als gering anzusehen ist, bzw. die Schwere der Schuld nicht entgegensteht, wird das Verfahren beendet und es erfolgt keine Eintragung in das Bundeszentralregister.[169] Gerade im Anwendungsbereich des § 153a StPO kann hier die Verteidigung einen wichtigen Beitrag leisten, wenn die Entscheidung zwischen einer geringen Geldstrafe und der Einstellung unter Auflage und Weisungen gefällt werden muss oder bereits ein Strafbefehl erlassen wurde, denn auch ein rechtskräftiger Strafbefehl wird wie die Verurteilung gem. § 4 Nr. 1 BZRG i.V.m. § 410 Abs. 3 StPO in das Bundeszentralregister eingetragen.[170]
Neben der Verteidigung gab es weitere Faktoren, die eine Einstellung unter Auflage nicht im engeren Sinn begünstigt haben, aber bei der Ermessensentscheidung der Staatsanwaltschaft oder der Richter:innen berücksichtigt wurden. Neben einer Entschuldigung der Beschuldigten, einem geringen Schaden, fehlenden Vorstrafen oder der Anzeigeerstattung durch nur eine:n der Geschädigten, fand auch eine alkoholisierte Enthemmung oder eine psychische Vorerkrankung Berücksichtigung.
4. Schwellenwert strafwürdigen Handelns
Begünstigende Faktoren oder für den:die Beschuldigte:n positive oder entlastende Faktoren können die Waagschale im Rahmen der Ermessensentscheidung der Staatsanwaltschaft oder der Richter:innen für den Beschuldigten ausschlagen lassen. Dies sagt aber noch nichts über den Schwellenwert strafwürdigen Handelns aus, aufgrund dessen die Waagschale trotz der entlastenden Tatsachen zur anderen Seite tendiert. Hier bot sich ein Vergleich der analysierten Verfahrensakten zu den Verurteilungen und den Verfahrenseinstellungen an. Die Ausgangsposition bildeten die Tathandlungen und Tatumstände, die weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen Gründen genügend Anlass zur Erhebung einer öffentlichen Klage boten und zur Verfahrenseinstellung nach § 170 Abs. 2 StPO führten. Die Schwelle begann bei den Vergehen, denen eine Verfahrenseinstellung nach § 153 Abs. 1 StPO zugrunde lag, die also nur eine geringe Schuld aufwiesen und kein Interesse an einer öffentlichen Klage bestand. Den Höhepunkt der Schwelle bildeten die Vergehen, die nach § 153a StPO unter Auflage oder Weisungen eingestellt wurden. Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bestand, konnte aber durch die Erfüllung von Auflagen und Weisungen beseitigt werden. Ebenso bestand ein hinreichender Tatverdacht, nur die Schwere der Schuld durfte der Einstellung nicht entgegenstehen. Keine Ahndung der Tat wäre dem öffentlichen Interesse zuwidergelaufen, eine Strafmaßnahme – wie eine geringe Geldstrafe von 10 bis zu 50 Tagessätzen – erschien aber noch nicht notwendig. Demnach wäre die Schwelle strafwürdigen Handelns spätestens überschritten, wenn zu dieser Strafmaßnahme gegriffen wurde.[171] Dies kann im Wege der Hauptverhandlung mit einer Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB), einem Urteil bzw. einem Strafbefehl (§ 407 StPO) geschehen, der ebenfalls auf die Anwendung im Bereich der Straftaten der minder schweren Kriminalität begrenzt ist und dessen Fälle auch ohne Hauptverhandlung zur Entscheidung reif sind.[172]
Ein Vergleich der Sachverhalte der analysierten Verfahrenseinstellungen unter Geldauflage und der Verurteilungen zu geringen Geldstrafen[173] im Bereich von 10-50 Tagessätzen bildete hier zwei Stufen. Die erste Stufe zeigte sich bei Verfahren, die mit einer Geldstrafe von 20 bis 30 Tagessätzen durch einen Strafbefehl endeten. Die Tathandlungen befanden sich im Rahmen einfacher körperlicher Gewalt und siedelten sich dort im unteren Bereich an: Schubsen ohne hohen Kraftaufwand, ein Schlag auf die Hand bei der Fesselung sowie sog. Zappelwiderstände, bei denen Körpertreffer nicht gezielt, sondern zufällig erfolgten. Verletzt wurde dabei niemand. In diesem Bereich befanden sich ebenfalls die meisten Verfahrenseinstellungen unter Auflage. Hier fanden sich genauso Schubser, Schläge in Richtung der Einsatzkräfte, ein Umsichtreten bei der Festnahme oder ein Losreißen aus der Fixierung. In beiden Vergleichsgruppen fanden die Verfahren vor und nach der Reform statt und in beiden Gruppen waren die Beschuldigten teilweise (nicht unerheblich) alkoholisiert. Einen augenfälligen Unterschied hinsichtlich des Verfahrensausgangs verteidigter oder nicht verteidigter Beschuldigter gab es nicht, ebenso nicht bei der Verortung der Verfahren in den Bundesländern (bspw. Nord-Süd-Gefälle). Bei dieser ersten Stufe des Vergleichs konnte somit kein Unterschied in der Schwelle strafwürdigen Handelns festgestellt werden. Anders stellte sich dies auf der zweiten Stufe dar. Diese bildeten Verfahren, die mit einer Geldstrafe von 40 bis 50 Tagessätzen durch Strafbefehl oder Urteil beendet wurden. Hier wurde seitens der Beschuldigten ebenfalls einfache körperliche Gewalt angewendet, jedoch erfolgten die Schläge, Tritte und Kopfstöße gezielt gegen die Einsatzkräfte. Hinzu kam in etwa der Hälfte der Fälle eine Gefährdung Dritter. So wurden bspw. Rettungskräfte an dem Betreten eines brennenden Hauses gehindert oder versucht, die Versorgung Bewusstloser oder zuvor Geschädigter zu unterbinden. Weiterhin charakteristisch waren in dieser Vergleichsgruppe die Verletzungen auf Seiten der Einsatzkräfte, die teilweise nicht unerheblich waren (Platz- und Risswunden, Sehnenriss an der Hand). Weitere Unterschiede zu den Verfahrenseinstellungen unter Auflage gab es auch hier nicht.
Die Schwelle strafwürdigen Handelns lag bei den analysierten Verfahrensakten somit bei gezielten Angriffen in Form von Schlägen, Stößen und Tritten, die zu einem nicht unerheblichen Personenschaden oder zu einer Gefährdung Dritter geführt haben.
VII. Zusammenfassung
Das Forschungsziel von GeVoRe war es, die Auswirkungen des 52. Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches auf Täter:innen, Opfer und Strafverfolgungsbehörden zu untersuchen.
Der Fokus auf die Eskalationsdynamiken hat zum großen Teil die Befunde in der Literatur bestätigt. Weit überwiegend wurden Fälle bekannt, bei denen die Täter:innen männlichen Geschlechts und mittleren Alters waren. Unter den untersuchten Fällen fanden sich bei 40 % der Beschuldigten bereits Vorstrafen. Auf Seiten der Vollstreckungsbeamt:innen und Rettungskräfte konnte ebenfalls das männliche Geschlecht und ein jüngeres Alter als Risikofaktor ausgemacht werden. Am häufigsten kam es bei den Widerständen zur Anwendung einfacher körperlicher Gewalt. Sehr selten wurde jemand schwerwiegend verletzt. Aber auch Ängste und psychische Folgen wurden berichtet oder konnten den analysierten Verfahrensakten entnommen werden.
Am häufigsten wurden Polizeivollzugsbeamt:innen der Bereitschafts- und Schutzpolizei Opfer von Gewalt. Das Gewaltverständnis der Betroffenen variierte zwischen einem rein rechtlichen und einem sehr weiten, so dass aus letzterer Sicht bereits Beleidigungen als Form psychischer Gewalt aufgefasst wurden. Als respektlos werteten Einsatzkräfte das Verhalten von Dritten, indem sie die Dienstausübung behinderten, filmten, die Einsatzkräfte verbal attackierten oder bedrohten. Subjektiv empfanden sie ihre Tätigkeit geprägt von physischer und psychischer Gewalt und deuteten teilweise diese Handlungen als Anfeindung gegen den Staat. Sie führten dies auf mangelnde Erziehung, die Migrationskrise und eine Verschiebung von Werten zurück. Aber nicht nur Einsatzkräfte empfanden einen zunehmenden Respektverlust. Auch die interviewten Bürger:innen berichteten von negativen Erfahrungen mit Polizeibeamt:innen. Für sie spielte die Kommunikation und der Umgang eine zentrale Rolle, wobei sie oft ein einzelnes Fehlverhalten auf die gesamte Institution der Polizei projizierten.
Als Haupteskalationsfaktor konnte auch im Rahmen von GeVoRe der Alkoholeinfluss identifiziert werden. Psychische Erkrankungen, die seitens der Einsatzkräfte nicht erkannt wurden oder den Einsatz erschwerten, trugen zu Eskalationen bei. Im Rahmen der Aktenanalyse zeigte sich jedoch, dass unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Substanzen auch in Fällen des tätlichen Angriffs weit überwiegend einfache Körperverletzungen oder gar keine Körperverletzungsdelikte neben die Widerstandstaten traten. In nur 22 % der Fälle ging eine qualifizierte Körperverletzung mit dem Widerstandsdelikt einher. Entgegen der in der Literatur beschriebenen Befunde, dass eine einmal begonnene Maßnahme durch die handelnden Einsatzkräfte konsequent durchgezogen und ein Rückgang zu gewaltfreier Kommunikation als nicht mehr möglich erachtet werde[174], wurde in der Aktenanalyse nicht bestätigt. Derartige kommunikative Interaktionsabläufe wurden sichtbar und wirkten deeskalierend. Sprachbarrieren führten häufig zu Auseinandersetzungen, da eine Kommunikation nur sehr eingeschränkt möglich war. Das Erfragen des Grundes für eine polizeiliche Maßnahme wurde von den interviewten Polizeibeamt:innen als aggressiv und provozierend beschrieben und als feindselig und beleidigend empfunden. Trotz ruhiger und sachlicher Kommunikation werde schließlich mit Ignoranz reagiert. Ein weiterer wesentlicher eskalativer Faktor war das Eindringen in die Intimsphäre, sowohl körperlicher Art (Bsp.: Berühren der beschuldigten Person) als auch ein Eindringen in den geschützten Wohnbereich (Bsp.: Fälle häuslicher Gewalt). Zur Eskalation selbst kam es in den meisten Fällen bei der Durchsetzung der konkreten Maßnahme. Von den befragten Bürger:innen wurde der Eskalationspunkt mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs gleichgesetzt. Die Analyse der Interaktionsdynamiken hat aufgezeigt, dass sich die Sachverhalte, bei denen sich Widerstandsdelikte ereignen, vor und nach der Gesetzesreform kaum unterscheiden. Dem „erhöhten Gefährdungspotential“ – wie es im Gesetzentwurf heißt[175] – konnte somit durch die Änderung der §§ 113 ff. StGB nicht begegnet werden.
Erklärtes Ziel des Änderungsgesetzes war es unter anderem auch, den spezifischen Unrechtsgehalt von Angriffen auf Vollstreckungsbeamt:innen und Rettungskräfte im Strafausspruch deutlich werden zu lassen. Begründet wurde dies mit einer Steigerung der Fallzahlen.[176] Die PKS weist jährlich mehr Widerstandsdelikte (§§ 113, 114, 115 StGB) im Vergleich zum Vorjahr auf. Im Jahr 2020 schlugen 36.760 Delikte zu Buche, bis 2023 steigerte sich die Anzahl der Fälle auf 42.982 Widerstandstaten.[177] Dabei verzeichnet der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamt:innen jährlich im Vergleich zum einfachen Widerstand eine größere Steigerung.[178] Im Gespräch mit den Expert:innen nahm ein Gros von ihnen sowohl einen Zuwachs an gewalttätigen Handlungen als auch eine zunehmende Intensität der Angriffe wahr. GeVoRe lieferte jedoch auch einige Anhaltspunkte dafür, dass mit der Gesetzesänderung 2017 auch ein verändertes Anzeigeverhalten der Rettungskräfte einherging. Dies berichteten nicht nur Richter:innen und Strafverteidiger:innen in den Expert:inneninterviews, sondern es fanden sich ebenfalls Hinweise dafür in den Verfahrensakten. In 39 % der untersuchten Fälle nach der Gesetzesreform wurde das Verfahren gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, weil der Tatbestand der §§ 113, 114 StGB nicht erfüllt wurde.
Zu erwarten wäre hinsichtlich des Strafmaßes gewesen, dass dieses nach der Gesetzesreform dem Willen des Gesetzgebers entsprechend deutlich gestiegen wäre. Dies zeigte sich jedoch nicht so deutlich. Insgesamt gab es nach der Reform eine abnehmende Tendenz schwerer Strafen. Am deutlichsten bei den unbedingten Freiheitsstrafen. Während diese Sanktionsform in den untersuchten Fällen vor der Reform in ca. 17 % aller Fälle verhängt wurde, wurden nach der Reform nur noch 8 % aller Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Die durchschnittliche Dauer der unbedingten Freiheitsstrafen betrug zwar vor der Reform mit acht Monaten deutlich weniger als nach der Reform, wo im Durchschnitt eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten verhängt wurde. Die deutlich höheren Freiheitsstrafen, die nach der Reform verhängt wurden, sind jedoch auf die besonders schweren Fälle zurückzuführen. Nimmt man diese heraus, zeigt sich sogar ein leichter Rückgang in der Dauer der verhängten Freiheitsstrafen. Diese betrugen im Durchschnitt nur fünf Monate nach der Reform; vor der Reform lag die durchschnittliche Dauer mit etwa fünfeinhalb Monaten etwas höher. Der Rückgang unbedingter und bedingter Freiheitsstrafen hat zur Folge, dass deutlich mehr Geldstrafen ausgeurteilt wurden. Ein deutlicher Anstieg ist vor allem im Bereich der Geldstrafen festzustellen, die im Wege eines Strafbefehlsverfahrens festgesetzt wurden. Von allen der Auswertung zugrunde liegenden Akten, in denen Geldstrafen nach dem 30.5.2017 ergingen, waren 63 % durch ein Strafbefehlsverfahren festgesetzt. Berichten der Expert:innen zur Folge handelte es sich in der Mehrzahl der Fälle um Handlungen, die als Ausdruck einer Weigerungshaltung an der polizeilichen Maßnahme aktiv mitzuwirken begriffen werden kann, ohne dass es zu körperlichen Schädigungen komme. Dies konnte die Aktenanalyse bestätigen. § 113 StGB bietet vor allem im Stadium der ersten polizeilichen Bewertung mit Blick auf das Tatbestandsmerkmal der „Gewalt“ einen erheblichen Beurteilungsspielraum, der sich teilweise auch in Bewertungsdiskrepanzen niederschlagen kann.
Expert:innen sahen die Entwicklungstendenz, dass durch die Herauslösung des tätlichen Angriffs eine Verengung des rechtsdogmatischen Anwendungsbereichs der Norm stattgefunden hat. Bezogen auf Waffen oder gefährliche Gegenstände schätzten sie die Praxisrelevanz als gering ein. Mit Blick auf den tätlichen Angriff schilderten die Expert:innen Handlungen, die typischerweise eine einfache Körperverletzung darstellen. Begrüßt wurde von Expert:innen der Polizei, dass sich die polizeipraktische Arbeit im Bereich des tätlichen Angriffs vereinfacht habe, da nunmehr subjektive Absichten oder Motive nicht nachgewiesen werden müssen. Im Übrigen wurde die Definition von allen Interviewpartner:innen als problematisch angesehen und von manchen als „unbestimmt“ oder „absurd weit“ bezeichnet. Teilweise bestand daher die Forderung nach einer klaren Definition des Begriffs. Insbesondere eine Einordnung niederschwelliger Handlungen unter den tätlichen Angriff wurde von Expert:innen aus der Strafverteidigung als unverhältnismäßig empfunden. Sie beklagten, dass die Polizei nicht nur durch ihre Eigenschaft als Strafverfolgungsbehörde, sondern auch durch den subjektiven Einfluss in Bezug zur Einschätzung einer möglichen Gefahrenlage, über eine Definitionsmacht verfüge. Staatsanwält:innen und Richter:innen verneinten diese, da die rechtliche Prüfung letztlich nicht im polizeilichen Bereich liege. Deutlich wurde aber, dass Polizeibeamt:innen als Berufzeug:innen vor Gericht ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird. Gestützt wurden diese Aussagen auf die berufliche Stellung und die rechtlichen Folgen einer Falschaussage. Strafverteidiger:innen sahen den von der Justiz entgegengebrachten Vertrauensvorschuss im Hinblick auf die Unschuldsvermutung als problematisch an und sprachen vereinzelt sogar von einer Beweislastumkehr. Auf eine unter Umständen schwierige Beweislage deutete auch der Befund der Aktenanalyse hin, dass Verletzungen von Beschuldigten nur selten genauso dezidiert dokumentiert wurden, wie die der Polizeibeamt:innen selbst.
Polizeibeamt:innen standen der Gesetzesänderung überwiegend positiv gegenüber und sahen eine klare kriminalpolitische Notwendigkeit der Neuregelung. Etwaige Strafbarkeitslücken vor der Gesetzesänderung verneinten sie jedoch, genau wie die befragten Staatsanwält:innen und Richter:innen. Sie waren sich einig, dass die bestehenden Strafrahmen schon vor der Gesetzesänderung hätten besser ausgeschöpft werden können. Die Jurist:innen begrüßten zum Teil, dass in Fällen, in denen die tätliche Gewalt im Vordergrund stehe, die Strafe nun einfacher und schneller erfolgen könne, während ein anderer Teil das neue Strafmaß als überzogen wertete und insbesondere beklagte, dass vor Gericht die Gelegenheit genommen werde, ein gewisses Augenmaß walten zu lassen.
Während Polizeibeamt:innen in der Gesetzesänderung ein politisches Signal erkannten, das eine gewisse Wertschätzung und einen Fürsorgegedanken gegenüber der Exekutive zum Ausdruck bringe, wurde die kriminalpolitische Notwendigkeit von den Strafverteidiger:innen einhellig in Abrede gestellt. Generalpräventive Aspekte der Gesetzesänderung wurden lediglich von den Polizeibeamt:innen geäußert. Die befragten Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen bezweifelten eher eine abschreckende Wirkung. Die Expert:innen sahen aber unterschiedliche Möglichkeiten, den Schutz von Einsatzkräften zu verbessern. Während Polizeibeamt:innen den Fokus auf eine konsequente Anwendung der Vorschriften legten, wurden auch präventive Maßnahmen, wie die Verbesserung personeller Ressourcen bei der Polizei, Transparenz, Fehlerkultur sowie ausbildungsspezifische Inhalte und Schulungen angesprochen. Weitere Strafschärfungen, wie sie zuletzt im Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU[179] gefordert wurden, lehnten alle Expert:innen – auch die Polizeibeamt:innen – ab. Vereinzelt wurden Ausnahmen hinsichtlich der Umgestaltung der Regelbeispiele gemacht.
In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird zum Teil eine Erheblichkeitsschwelle als einschränkendes Korrektiv für die weite Definition des tätlichen Angriffs gefordert. Zur Möglichkeit einer solchen restriktiven Auslegung wurden die Jurist:innen befragt. Kritisiert wurde, dass mit der Einführung einer Erheblichkeitsschwelle ein weiteres Definitionsproblem geschaffen werde, da der Begriff der Erheblichkeit zu unbestimmt sei. Einige verwiesen auf die Opportunitätseinstellungen, die in einem solchen Fall bereits Abhilfe schaffen können. Etwa die Hälfte der Staatsanwält:innen sah die Notwendigkeit der Einführung eines minderschweren Falls. Sie begründeten diese anhand der weiten Auslegung des tätlichen Angriffs und des daraus resultierenden Erfordernisses eines einschränkenden Korrektivs, um eine gerechtere Entscheidung im Einzelfall zu ermöglichen. Die andere Hälfte lehnte dies unter Hinweis auf bereits bestehende Möglichkeiten des StGB und der StPO ab. Auch ein Großteil der Richter:innen und Strafverteidiger:innen begrüßte die Einführung eines minder schweren Falles. Die Möglichkeiten im Rahmen der Opportunitätseinstellungen in Bezug auf Widerstandsdelikte wurde ebenfalls mit den Jurist:innen diskutiert. Ihrer Meinung nach wurde von den Einstellungsmöglichkeiten unabhängig von der Herauslösung des tätlichen Angriffs bereits vor der Gesetzesänderung restriktiv Gebrauch gemacht. Gründe dafür sahen sie in der besonderen Schutzbedürftigkeit der Einsatzkräfte. In der Praxis haben sich ihren Berichten zufolge folgende Fallkonstellationen herausgebildet, in denen eine Einstellung in Frage komme:
- Sachverhalte, in denen die Schuldfähigkeit der:des Beschuldigten wegen Alkoholkonsums oder psychischer Erkrankungen fraglich ist und aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit auf ein entsprechendes Gutachten verzichtet wird
- Sachverhalte, bei denen Beschuldigte zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, geständig waren oder sich entschuldigt haben
- Sachverhaltskonstellationen, in denen keine oder geringe Verletzungsfolgen eingetreten sind und der Unrechtsgehalt der Tat als sehr gering eingeschätzt wird (sog. Zappelwiderstände)
- Sachverhaltskonstellationen, bei denen die eingetretenen (Verletzungs-)Folgen bei dem:der Beschuldigten nicht unerheblich sind.
Die „geringe Einstellungsbereitschaft“ wurde seitens der Verteidiger:innen als äußerst kritisch betrachtet, vor allem stieß sie auf Irritationen vor dem Hintergrund der strafprozessualen Gleichbehandlung.
Die beschriebenen Fallkonstellationen konnten mit der Verfahrensaktenanalyse bestätigt werden. Aufgefallen ist im Bereich der Verfahrenseinstellungen wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) eine Steigerung der Fälle nach der Gesetzesreform. Im Gegenzug dazu nahm das Absehen von der Verfolgung unter Auflagen (§ 153a StPO) nach der Gesetzesreform ab. Dies veranlasste die Frage nach dem Schwellenwert strafwürdigen Handelns. Dazu wurde ein Vergleich der Sachverhalte der analysierten Verfahrenseinstellungen unter Geldauflage und der Verurteilungen zu geringen Geldstrafen im Bereich von 10-50 Tagessätzen angestellt. Die Schwelle strafwürdigen Handelns lag bei gezielten Angriffen in Form von Schlägen, Stößen und Tritten, die zu einem nicht unerheblichen Personenschaden führten oder Dritte gefährdeten. Im Bereich der Verfahrenseinstellungen unter Auflage und der Geldstrafen von 20 bis 30 Tagessätzen per Strafbefehl waren die Sachverhalte nahezu identisch. Die Tathandlungen befanden sich im Rahmen einfacher körperlicher Gewalt und siedelten sich dort im unteren Bereich an. Welchen Ausgang die Verfahren hier nahmen, mutete zufällig an. Auch weitere augenfällige Unterschiede (bspw. Nord-Süd-Gefälle) gab es nicht.
VIII. Fazit
Gewalt gegenüber Einsatzkräften betrifft ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, das Gegenstand des Forschungsprojektes GeVoRe war. Es zielte sowohl auf die Analyse der eskalierenden Interaktionsdynamiken als auch deren rechtlichen Einordnung im Lichte der Gesetzesänderung der §§ 113 ff. StGB ab.
Gewaltvorfälle betreffen überwiegend einfache körperliche Einwirkungen, schwere Verletzungen sind selten. Eskalationen entstehen meist in Verbindung mit Alkoholkonsum, psychischen Erkrankungen oder Drogenkonsum und verlaufen über abrupte, schrittweise oder von Beginn an hochaggressive Dynamiken. Sie werden weniger durch einzelne Faktoren, sondern durch das Zusammenspiel von situativen Umständen, emotionalen Zuständen und Interaktionsmustern bestimmt.
Insgesamt ist festzuhalten, dass das Ziel der Reform durch das 52. Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht werden konnte. Der Schutz von Polizeivollstreckungsbeamt:innen sowie ihnen gleichgestellte Personen durch eine verbesserte Strafverfolgung sowie eine höhere Bestrafung durch die Täter:innen ist weitgehend ausgeblieben. Trotz der Limitierungen aufgrund der geringen Stichprobe zur Aktenanalyse ist deutlich geworden, dass eine höhere Bestrafung der Täter:innen ausgeblieben oder allein dem Umstand geschuldet ist, dass durch Streichung der Verwendungsabsicht das Regelbeispiel eines besonders schweren Falls häufiger bejaht werden kann. Die Streichung der Verwendungsabsicht wird aber nicht nur in der Literatur, sondern auch weitgehend von den interviewten Expert:innen als durchaus kritisch angesehen.
Auch die Herauslösung des Angriffs aus § 113 StGB unter deutlicher Erhöhung des Strafrahmens führt zu Problemen in der Praxis, wie die Expert:inneninterviews verdeutlichen. Die angestrebte verbesserte Strafverfolgung im Sinne erhöhter Fallzahlen ist zudem nicht unbedingt der Gesetzesänderung geschuldet, sondern könnte auch an einem geänderten Anzeigeverhalten liegen. Hinzu kommt, dass steigende Fallzahlen eher darauf hindeuten, dass ein besserer Schutz von Polizeivollstreckungsbeamt:innen und ihnen gleichgestellten Berufsgruppen durch die Reform gerade nicht hergestellt werden konnte. Dies wird auch durch die Expert:inneninterviews zu den Eskalationsdynamiken bekräftigt, die nahelegen, dass Risikofaktoren u.a. psychisch Kranke sowie alkoholisierte Personen sind, die durch entsprechende Gesetzesverschärfungen in der aktuellen Handlungssituation gerade nicht normativ ansprechbar sind. Vielmehr können Kommunikationsstrategien deeskalierend wirken, so dass eine spezielle Schulung der Einsatzkräfte viel zielführender erscheint, um Widerstandsdelikte zu vermeiden. Dabei sind die Kommunikationsstrategien den unterschiedlichen Einsatzszenarien anzupassen, da diese – schon unter Berücksichtigung des Einsatzortes, der Anzahl der Beteiligten oder der psychischen Verfasstheit der beteiligten Bürger:innen – variieren.
Insgesamt unterstreicht der Bericht die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung: Gewalt gegen Einsatzkräfte ist weder ein randständiges noch ein homogenes Problem, sondern erfordert differenzierte Präventionsstrategien, die situative Eskalationsdynamiken, organisationskulturelle Aspekte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen gleichermaßen berücksichtigen. Für Forschung und Praxis ergibt sich daraus die Aufgabe, die Datengrundlage zu verbessern, die Perspektiven der Betroffenen systematisch einzubeziehen und Prävention weniger symbolisch, sondern stärker evidenzbasiert auszurichten.
[1] BGBl. I 2017, S. 1226.
[2] Siehe hierzu den Beitrag von Schiemann, KriPoZ 2025, 58 ff.
[3] Details zu den unterschiedlichen Gesetzentwürfen sowie eine Zusammenfassung der Öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss vom 14.10.2024 unter: https://kripoz.de/2024/07/05/staerkung-des-schutzes-von-vollstreckungsbeamten-und-rettungskraeften-sowie-sonstigen-dem-gemeinwohl-dienenden-taetigkeiten/ (zuletzt abgerufen am 19.2.2025).
[4] Glaser/Strauss, the Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research,1967.
[5] Glaser/Strauss, the Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, S. 38 f.
[6] Auf eine ausführliche Wiedergabe des Standes der Forschung wird an dieser Stelle verzichtet.
[7] Staack, in: Stark (Hrsg.), Soziologie und Polizei, 2015, S. 125 (133).
[8] Idealerweise hätten die Interviews im Abgleich mit den jeweiligen Verfahrensakten eine komplementäre Perspektive auf denselben Sachverhalt eröffnet, sodass sowohl institutionalisierte Darstellungen als auch subjektive Deutungen in die Analyse einfließen hätten können. Dieses Vorgehen konnte jedoch aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht realisiert werden.
[9] Insgesamt wurden 180 Strafverfahrensakten aus 16 Bundesländern ausgewertet. Darunter befanden sich sechzig Verfahrensakten, die entweder im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren oder im Hauptverfahren mit einer Einstellung oder einem Freispruch endeten. Knapp die Hälfte der Akten stammte aus den drei bevölkerungsstärksten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.
[10] Von den 120 ausgewerteten Verfahren, die mit einer Verurteilung endeten, ereigneten sich 46 Fälle vor dem 30.5.2017, also vor Inkrafttreten der Gesetzesänderungen der §§ 113 ff. StGB und 74 Verfahren stammten aus der Zeit nach der Reform der Widerstandsdelikte. Von den 60 Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen stammen 26 Akten aus der Zeit vor der Reform und 34 Akten aus der Zeit nach der Gesetzesänderung.
[11] Bei den Expert:inneninterviews mit Polizeibeamt:innen wurde darauf geachtet, die Führungsebene sowie die Sachbearbeiter:innenebene zu berücksichtigen. Daher wurden 15 Interviews mit Führungskräften und 15 Interviews mit Sachbearbeiter:innen geführt. Zudem fanden 17 Interviews mit Staatsanwält:innen, 18 Interviews mit Verteidiger:innen und 13 Interviews mit Richter:innen statt.
[12] Insgesamt wurden im Rahmen der problemzentrierten Interviews 69 mit Polizeivollzugsbeamt:innen, 13 mit Rettungskräften und 10 mit Bürger:innen geführt.
[13] BGBl. I 2021, S. 441.
[14] So bereits BT-Drs. 17/4143, S. 6; h.M. vgl. nur Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, 57. Ed. (1.5.2023), § 113 Rn. 2; Paeffgen, in: NK-StGB, 6. Aufl. (2023), § 113 Rn. 3; Bosch, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. (2021), § 113 Rn. 1; Sänger, Die neuen §§ 113, 114, 115 StGB, 2023, S. 81 (aber unter dem Hinweis, dass er einen „Großteil seines Individualrechtsschutzes“ eingebüßt habe). Allerdings ist diese Auffassung strittig, vgl. bspw. Fischer, StGB, 70. Aufl. (2023), § 113 Rn. 2; Deiters, GA 2002, 259; Magnus, GA 2017, 530. Klar ablehnend Bolender, Das neue Widerstandsrecht, 2021, S. 95.
[15] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 2; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. (2019), § 113 Rn. 2; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 1.
[16] S. nur Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 113 Rn. 2; ausf. Paeffgen, in: NK-StGB, § 113 Rn. 3.
[17] Fischer, StGB, § 114 Rn. 2; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 114 Rn. 2.
[18] BT-Drs. 18/11161, S. 1.
[19] S. bspw. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 10; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, 2. Aufl. (2020), § 113 Rn. 3.
[20] Fischer, StGB, § 113 Rn. 3.
[21] Vgl. Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 5; Fischer, StGB, § 113 Rn. 7.
[22] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 11 sowie Fischer, StGB, § 113 Rn. 8 m.Bsp.
[23] Vgl. BGH, NJW 1974, 1254 (1255); KG, NStZ 1989, 121; BGH, NJW 1982, 2081.
[24] Vgl. mit Fallbeispielen ausf. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 12 sowie Paeffgen, in: NK-StGB, § 113 Rn. 17; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 113 Rn. 13.
[25] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 12 m.w.N. sowie Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 113 Rn. 5 und Rosenau, in: LK-StGB, 13. Aufl. (2021), § 113 Rn. 19 mit Bsp. aus der Rspr.
[26] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 7a; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 6.
[27] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 17; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 7.
[28] Vgl. Fischer, StGB, § 113 Rn. 22; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. (2023), § 113 Rn. 5; a.A. Wolters, in: SK-StGB, 9. Aufl. (2017), § 113 Rn. 23.
[29] Vgl. mit Bsp. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 17; vgl. auch Fischer, StGB, § 113 Rn. 25.
[30] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 18; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 8; m. zahlr. Rspr.Bsp. Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 24.
[31] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 19.
[32] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 23; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 113 Rn. 18; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 8.
[33] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 20; Fischer, StGB, § 113 Rn. 25; LG Nürnberg-Fürth, NStZ-RR 2021, 169 f. zu letzterem Beispielfall. Zu zahlreichen weiteren Beispielen aus der Rechtsprechung vgl. Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 24.
[34] AG Berlin-Tiergarten, BeckRS 2022, 50575; a.A. KG, NZV 2023, 461 m. krit. Anm. Preuß. Gewalt wird auch nach Fischer, StGB, § 113 Rn. 24 bejaht, sofern die Loslösung einige Minuten dauert.
[35] So Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 24.
[36] S. OLG Dresden, NStZ-RR 2015, 10.
[37] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 24.
[38] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 23; Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 12.
[39] S. Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 25; Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 23.
[40] Die dogmatische Verankerung dieses Kriteriums ist äußerst umstritten und reicht von der Annahme einer objektiven Strafbarkeitsbedingung über eine Tatbestandslösung oder Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination bis hin zur sog. Rechtfertigungslösung. Vgl. hierzu ausführlich Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 25 ff. Die praktische Bedeutung dieser Streitfrage ist aber gering, s. Fischer, StGB, § 113 Rn. 10.
[41] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 11 m. zahlr. Nachw. aus Rspr. und Literatur. Auch der Gesetzgeber hat diesen Begriff bei der Neufassung des § 113 StGB zugrunde gelegt, vgl. Prot. VI/304; BT-Drs. VI/502, S. 4 f.
[42] Vgl. BGH, NJW 1953, 1032; NJW 2015, 3109; Fischer, StGB, § 113 Rn. 11; Paeffgen, in: NK-StGB, § 113 Rn. 35 jew. m.w.N.
[43] Ausf. zu den formellen und materiellen Voraussetzungen Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 38 ff.; Paeffgen, in: NK-StGB, § 113 Rn. 35 ff.
[44] S. Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 113 Rn. 19; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, § 113 Rn. 10.
[45] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 54; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 113 Rn. 20.
[46] BT-Drs. VI/502, S. 5.
[47] BT-Drs. 18/11161, S. 9.
[48] Vgl. Zöller, KriPoZ 2017, 143 (149); sowie Schiemann, in: FS Prittwitz, 2023, S. 739 (745) m.w.N. und Sänger, S. 155.
[49] Vgl. Fischer, StGB, § 244 Rn. 4 m.w. Bsp.
[50] Schmitz, in: MüKo-StGB, § 244 Rn. 14. Im Einzelnen sind freilich die Anforderungen an das Werkzeug umstritten, ausf. Brodowski, in: LK-StGB, § 244 Rn. 14.
[51] S. Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 80; Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 75.
[52] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 77; Fischer, StGB, § 113 Rn. 38.
[53] S. Fischer, StGB, § 113 Rn. 38; mit ausf. Begründung Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 91.
[54] S. Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 90 unter Hinw. auf die Rspr. zu § 224: BGH, NJW 2002, 3788; vgl. auch Fischer, StGB, § 113 Rn. 39; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, § 113 Rn. 30; kritisch Sänger, S. 156 f.
[55] BT-Drs. 18/11161, S. 1, 10; Bolender, S. 184, weist darauf hin, dass die Bestimmung des Rechtsguts des § 114 StGB „durchaus schwerfällt“.
[56] S. Schiemann, NJW 2017, 1846 (1847); Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 114 Rn. 4; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, § 114 Rn. 1.
[57] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 114 Rn. 7.
[58] So Rosenau, in: LK-StGB, § 114 Rn. 11.
[59] S. Schiemann, NJW 2017, 1846 (1847); Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 114 Rn. 4; Bosch, in: MüKo-StGB, § 114 Rn. 7.`
[60] Schiemann, NJW 2017, 1846 (1847); Rosenau, in: LK-StGB, § 114 Rn. 12.
[61] Fischer, StGB, § 114 Rn. 5; Rosenau, in: LK-StGB, § 114 Rn. 13.
[62] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 114 Rn. 6; Fischer, StGB, § 114 Rn. 5.
[63] So Busch/Singelnstein, NStZ 2018, 510 (512 f.); Bleckat, ZAP 2019, 1207 (1208); Puschke/Rienhoff, JZ 2017, 924 (930); Bolender, S. 229; Sänger, S. 120.
[64] S. Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 114 Rn. 5; Roggan, KriPoZ 2020, 144 (145); in diesem Sinne ebenfalls Sänger, S. 120.
[65] BGH, NJW 2020, 2347 (2348); krit. Singelnstein, NJW 2020, 2349.
[66] BGH, NJW 2020, 2347 (2348). Dem BGH folgend Rosenau, in: LK-StGB, § 114 Rn. 15; Schermaul, JuS 2019, 663 (665). Der Gesetzgeber äußert sich nicht zur Auslegung, s. BT-Drs. 18/11161, S. 9 f.
[67] S. Rosenau, in: LK-StGB, § 114 Rn. 16; Bosch, in: MüKo-StGB, § 114 Rn. 10.
[68] Vgl. Fischer, StGB, § 114 Rn. 7; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 114 Rn. 4.
[69] S. Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 115 Rn. 1; Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 1; Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 1.
[70] BT-Drs. 18/11161, S. 10.
[71] Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 1; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 115 Rn. 2; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 115 Rn. 3 f.
[72] Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 115 Rn. 3; Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 7.
[73] Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 9; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 115 Rn. 14 f.
[74] Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 2; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 115 Rn. 20; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 115 Rn. 1.
[75] Fassung vom 1.7.2021 mit der Erweiterung auf Angehörige von Notdiensten und Notaufnahmen.
[76] S. Fischer, StGB, § 115 Rn. 6; Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 10; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 115 Rn. 21.
[77] S. Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 115 Rn. 6; Fischer, StGB, § 115 Rn. 6; Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 10.
[78] S. Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 11; Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 17; Fischer, StGB, § 115 Rn. 7.
[79] S. Fischer, StGB, § 115 Rn. 8; mit Einzelbeispielen Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 11.
[80] S. Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 18; Fischer, StGB, § 115 Rn. 10.
[81] S. Heger/Jahn, JR 2015, 508 (511); Erb, KriPoZ 2018, 48 (50); Rosenau, in: LK-StGB, § 115 Rn. 22.
[82] Fischer, StGB, § 115 Rn. 12; Bosch, in: MüKo-StGB, § 115 Rn. 14.
[83] S. bspw. Ellrich et al., Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer Befragung von Polizeibeamten in zehn Bundesländern, 2012; Falk, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – ein praxisbezogenes Forschungsprojekt-, 2000; Ohlemacher et al., Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte 1985-2000, 2003.
[84] BT Plenarprotokoll 18/231, S. 23262 C, 23263 D.
[85] Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 18; Rosenau, in: LK-StGB, § 113 Rn. 23; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 113 Rn. 42; Fischer, StGB, § 113 Rn. 23; siehe zur Begriffsdefinition auch III. 1.
[86] S. Ellrich et al., Gewalt gegen Polizeibeamte. Ausgewählte Befunde zu den Tätern der Gewalt, S. 31 ff.
[87] Görgen/Nowak, Alkohol und Gewalt: eine Analyse des Forschungsstandes zu Phänomen, Zusammenhängen und Handlungsansätzen, 2013, S. 3.
[88] Derin/Singelnstein, Die Polizei: Helfer, Gegner, Staatsgewalt, 2022, S. 149.
[89] Bürger:in\1625046040-20210420_pzi_b: 167.
[90] Vgl. Sykes/Matza, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, American Sociological Review 1957, S. 664 (669).
[91] Staatsanwält:innen\1612266489-20200812_e_sta: 21.
[92] Polizeibeam:innen\1609940205-20200916_e-pol-a: 27.
[93] Staatsanwält:innen\1617116678-21200323_sta: 29.
[94] Staatsanwält:innen\1617116676-21200325_sta: 89.
[95] Staatsanwält:innen\1617116676-21200330_sta: 11.
[96] Staatsanwält:innen\1617116676-21200325_sta: 89.
[97] StaatsanwältInnen\1612266489-20200812_e_sta: 21.
[98] Strafrichter:innen\1606747139-20200821_e_strafri: 13.
[99] Polizeibeamt:innen\1609940206-20200928_e-pol-a: 15.
[100] Ebd.
[101] Ebd.
[102] Strafrichter:innen\20200709_e_strafri_a_0: 15.
[103] Strafrichter:innen\1606747143-20200708_e_strafri: 273.
[104] Polizeibeamt:innen\1609940199-20200728_e_pol: 92.
[105] Ebd.
[106] Polizeibeamt:innen\1609940196-20200715_e_pol_a: 9.
[107] Strafrichter:innen\20200707_e_strafri: 90.
[108] Strafrichter:innen\20200709_e_strafri_a_0: 15.
[109] Strafrichter:innen\1606747143-20200708_e_strafri: 277.
[110] Strafverteidiger:innen\1609934836-20201223_stv: 95.
[111] Strafverteidiger:innen\1609934833-20201113_stv-b: 25.
[112] Strafverteidiger:innen\1625052521-21200527_stv: 57.
[113] Strafverteidiger:innen\1609934833-20201211_stv-b: 9.
[114] Strafverteidiger:innen\1625052521-21200527_stv: 95; Strafverteidiger:innen\1609934831-20201113_stv-a: 39; Strafverteidiger:innen\1609934833-20201113_stv-b: 33; Strafverteidiger:innen\1609934834-20201118_stv: 11.
[115] Strafverteidiger:innen\1625052521-21200527_stv: 99.
[116] Polizeibeamt:innen\1609940196-20200715_e_pol_a: 21
[117] Staatsanwält:innen\16203828-21200426_sta-a: 15.
[118] Polizeibeamt:innen\1609940194-20200707_e_pol: 19.
[119] Staatsanwält:innen\1612266488-20200813_e_sta: 161.
[120] Staatsanwält:innen\1617116679-21200312_sta: 191.
[121] Strafverteidiger:innen\1625052517-21200611_stv: 15; Strafrichter:innen\20200716_e_strafri: 51; Strafrichter:innen\1606747139-20200821_e_strafri: 65.
[122] Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 113 Rn. 40/41.
[123] Polizeibeamt:innen\1625062250-20201212_e_pol: 159.
[124] Strafrichter:innen\1606747143-202006015_e_strafri: 65.
[125] Strafverteidiger:innen\1609934832-20201113_stv-c: 85.
[126] Ebd.
[127] Polizeibeamt:innen\1615294556-20200821_e_pol: 18.
[128] Strafverteidiger:innen\1625052519-21200601_stv: 37-39.
[129] Strafverteidiger:innen\1621428809-21200513_stv: 65-67.
[130] Strafverteidiger:innen\1625052519-21200601_stv: 46.
[131] Zum geschützten Rechtsgut der §§ 113 ff. StGB s.o.
[132] Staatsanwält:innen\1620380328-21200426_sta-a: 61.
[133] Staatsanwält:innen\1625046036-20210428_e_sta: 61.
[134] Polizeibeamt:innen\1609940195-20200713_e_pol: 21
[135] Zur Definition des tätlichen Angriffs s.o.
[136] Dallmeyer, in: BeckOK-StGB, § 114 Rn. 5.
[137] Polizeibeamt:innen\1609940201-20200901_e_pol: 77.
[138] Staatsanwält:innen\1612266489-20200812_e_sta: 31.
[139] Strafverteidiger:innen\1609934835-20201215_stv: 25.
[140] Feest, Definitionsmacht, Renitenz und Abolitionismus, 2020, S. 2.
[141] Staatsanwält:innen\1612266488-20200813_e_sta: 161.
[142] Staatsanwält:innen\1617116679-21200312_sta: 191.
[143] Zur Erheblichkeitsschwelle s.o.
[144] Staatsanwält:innen\1620380327-21200414_sta: 125.
[145] Staatsanwält:innen\1617116677-21200324_sta_b: 287
[146] Strafverteidiger:innen\20201210_stv: 131.
[147] Strafverteidiger:innen\1609934831-20201113_stv-a: 125.
[148] Bei den mit abgeurteilten Verfahren handelt es sich teilweise um weitere Strafverfahren wegen anderer Widerstandsdelikte derselben beschuldigten Person. Häufig wurden aber auch Verfahren miteinander verbunden, in denen de
Tatvorwurf außerhalb der §§ 113 ff. StGB lag.
[149] § 407 Abs. 2 StPO bestimmt, welche Rechtsfolgen durch Strafbefehl festgesetzt werden dürfen. Die Festsetzung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr darf nicht überschritten werden.
[150] BT-Drs. 18/11161, S. 1.
[151] Zur Methodik der Auswahl s.o.
[152] Im Unterschied zu § 206a StPO, erfolgt die Einstellung gemäß § 260 Abs. 3 StPO in der Hauptverhandlung durch Urteil, siehe dazu auch Tiemann, in: KK-StPO, 9. Aufl. (2023), § 260 Rn. 46 f.
[153] Eine Person ist nach Maßgabe des § 276 StPO abwesend, wenn der Aufenthalt unbekannt ist oder sie sich im Ausland aufhält und eine Vorführung vor das zuständige Gericht nicht angemessen oder ausführbar wäre, siehe dazu Wenske, in: MüKo-StPO, Bd. 2, 2016, § 205 Rn. 13 ff.
[154] Die Einstellung gem. § 154 StPO ist bei einer weiteren prozessualen Tat (§ 264 StPO) in Betracht zu ziehen, die – anders als bei den §§ 153 und 153a StPO – ahndungswürdig erscheint und nur in Bezug auf eine andere rechtskräftige Verurteilung nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde. Näher dazu Teßmer, in: MüKo-StPO, § 154 Rn. 6.
[155] Siehe Moldenhauer, in: KK-StPO, § 170 Rn. 13.
[156] Peters, in: MüKo-StPO, § 153 Rn. 16 f.; Diemer, in: KK-StPO, § 153 Rn. 5.
[157] Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Aufl. (2023), § 153 Rn. 4; Diemer, in: KK-StPO, § 153 Rn. 12.
[158] Mavany, in: LR-StPO, § 153 Rn. 25; Beukelmann, in: BeckOK-StPO, 48. Ed. (Stand: 1.7.2023), § 153 Rn. 12.
[159] Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 153 Rn. 4; Peters, in: MüKo-StPO, § 153 Rn. 27 f.; Pfordte, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, 5. Aufl. (2022), § 153 StPO Rn. 3.
[160] Diemer, in: KK-StPO, § 153a Rn. 1
[161] Peters, in: MüKo-StPO, § 153 Rn. 14; Diemer, in: KK-StPO, § 153a Rn. 1.
[162] Mavany, in: LR-StPO, § 153a Rn. 39; Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 153a Rn. 7; Beukelmann, in: BeckOK-StPO, § 153a Rn. 14.
[163] Beukelmann, in: BeckOK-StPO, § 153a Rn. 16; Gercke, in: Gercke/Zöller/Temming, StPO, 7. Aufl. (2023), § 153a Rn. 19.
[164] Schneider, in: BeckOK-JGG, 30. Ed. (Stand: 1.2.2023), § 45 Rn. 51.
[165] In welchem Verhältnis die Regelungen der §§ 45, 47 JGG und der §§ 153, 153a StPO zueinander stehen ist in der Literatur streitig. Näher dazu Höffler, in: MüKo-StPO, Bd. 3, 2018, § 45 JGG Rn. 9; Kölbel, in: Eisenberg/Kölbel, JGG, 24 Aufl. (2023), § 45 Rn. 9 ff.; Sommerfeld, in: Ostendorf, JGG, 11. Aufl. (2021), § 45 Rn. 5 f.
[166] Staatsanwält:innen\1617116678-21200324_sta_a: 193-201.
[167] Staatsanwält:innen\1617116676-21200325_sta: 55.
[168] Strafverteidiger:innen\1620380327-21200428_stv: 41.
[169] Peters, in: MüKo-StPO, § 153 Rn. 14; Diemer, in: KK-StPO, § 153a Rn. 1.
[170] Ausführlich dazu Maur, in: KK-StPO, § 410 Rn. 15.
[171] Vgl. Peters, in: MüKo-StPO, § 153 Rn. 19.
[172] Eckstein, in: MüKo-StPO, § 407 Rn. 1; Temming, in: BeckOK-StPO, § 407 Rn. 3.
[173] Wie bei der Analyse hinsichtlich des Strafmaßes ist zu beachten, dass im Rahmen der Verurteilungen teilweise Verfahren verbunden worden sind.
[174] Derin/Singelnstein, 2022, S. 149.
[175] BT-Drs. 18/11161, S. 1.
[176] BT-Drs. 18/11161, S. 1; BT-Drs. 18/11547, S. 1; kurz auch in BT-Drs. 18/12153, S. 1, 2.
[177] BKA, PKS 2020 und 2023, jew. T01 Grundtabelle – Fallentwicklung.
[178] Tätliche Angriffe: von 2020 zu 2021 6,3 %, von 2022 zu 2023 7,7 %; einfacher Widerstand: 2020 zu 2021 0,9 %, von 2022 zu 2023 3,8 %.
[179] BT-Drs. 20/13217.