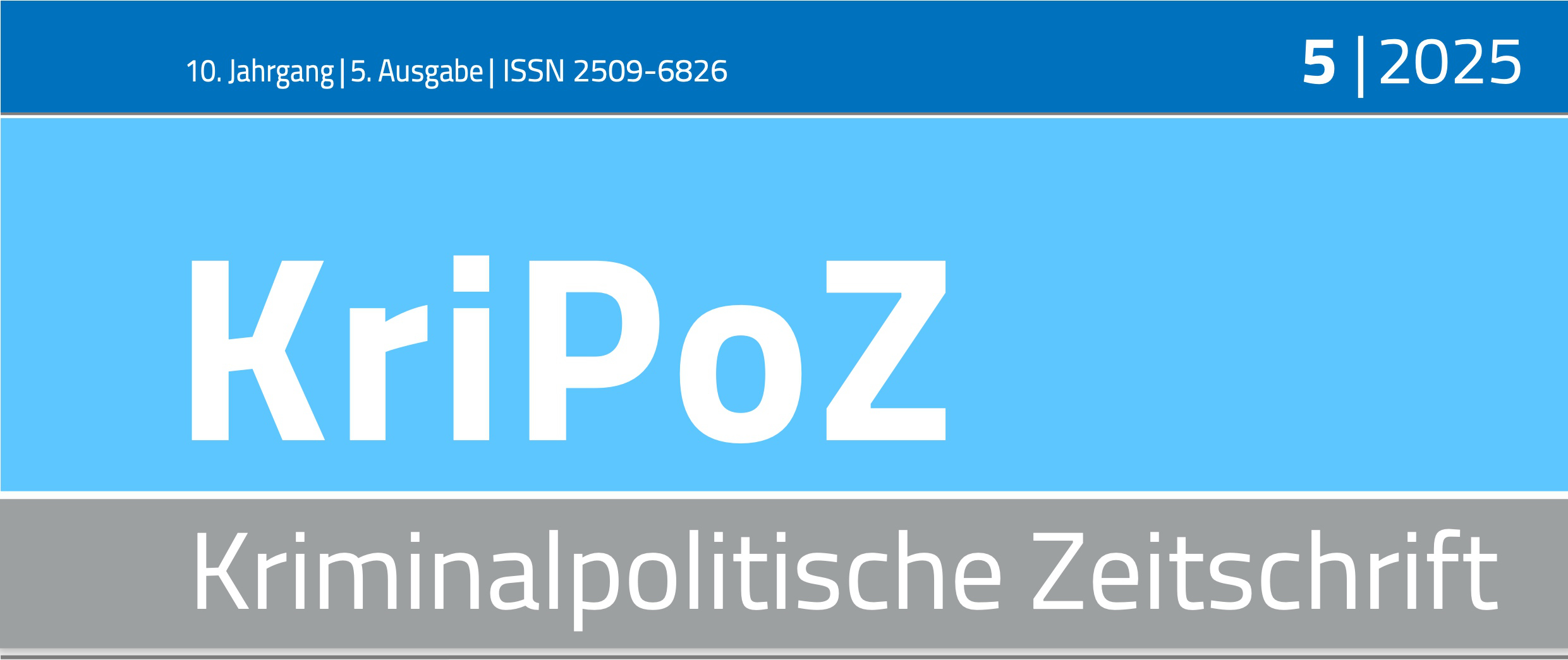Forderung nach wirksamerer Strafverfolgung
Sexuelle Gewalt als gezielte Kriegsstrategie ist kein neues Phänomen – doch ihre systematische Ahndung bleibt bis heute eine Herausforderung für das Völkerrecht. Anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag am 8. Oktober 2025 wurde erneut deutlich, wie dringend ein Umdenken in der internationalen Strafverfolgung notwendig ist. Zwei renommierte Juristinnen – Prof. Dr. Beate Rudolf und Prof. Dr. Ruth Halperin-Kaddari – forderten einen „Paradigmenwechsel“: weg von der rein individuellen Täterverfolgung, hin zu einem Konzept kollektiver Verantwortung bei sexualisierter Kriegsgewalt.
Bereits 2001 hatte der Internationale Strafgerichtshof sexualisierte Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Trotz dieser völkerrechtlichen Weichenstellung gelingt es bislang jedoch nur selten, Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Für Halperin-Kaddari, Juristin an der Bar-Ilan-Universität in Israel und Mitbegründerin des Dinah-Projekts zur Dokumentation sexualisierter Kriegsgewalt, ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ein erschütterndes Beispiel für den systematischen Einsatz sexueller Gewalt als Kriegswaffe. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team untersuchte sie Aussagen von Überlebenden sowie forensische Beweise. Ihr Fazit: Die Taten waren kein Zufallsprodukt, sondern Teil einer gezielten Strategie der Entmenschlichung und Machtausübung.
Bislang orientiert sich die Strafverfolgung stark am klassischen Tatnachweis: Täter, Tat, Opfer – in direkter Beziehung zueinander. Gerade bei sexualisierter Gewalt im Krieg ist ein solcher Nachweis jedoch oft kaum möglich, etwa weil Opfer verstorben, traumatisiert oder aus Angst zum Schweigen gezwungen sind. Halperin-Kaddari plädiert deshalb für eine Erweiterung des strafrechtlichen Verständnisses: Wer Teil einer Organisation ist, die sexualisierte Gewalt systematisch einsetzt, soll auch dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn er oder sie nicht selbst unmittelbar beteiligt war. Das Konzept „kollektiver Verantwortung“ müsse juristisch stärker verankert werden. Als Vorbild nannte sie das Urteil gegen John Demjanjuk (LG München, 2011), bei dem erstmals die bloße Zugehörigkeit zu einem Vernichtungssystem ohne konkreten Tatnachweis zur Verurteilung führte. Auch Rudolf verwies auf die Bedeutung solcher Urteile für die Weiterentwicklung des Völkerrechts. Deutschland und andere Staaten müssten sich international für rechtliche Reformen, gezielte Sanktionen und eine konsequentere Strafverfolgung sexualisierter Kriegsgewalt einsetzen.