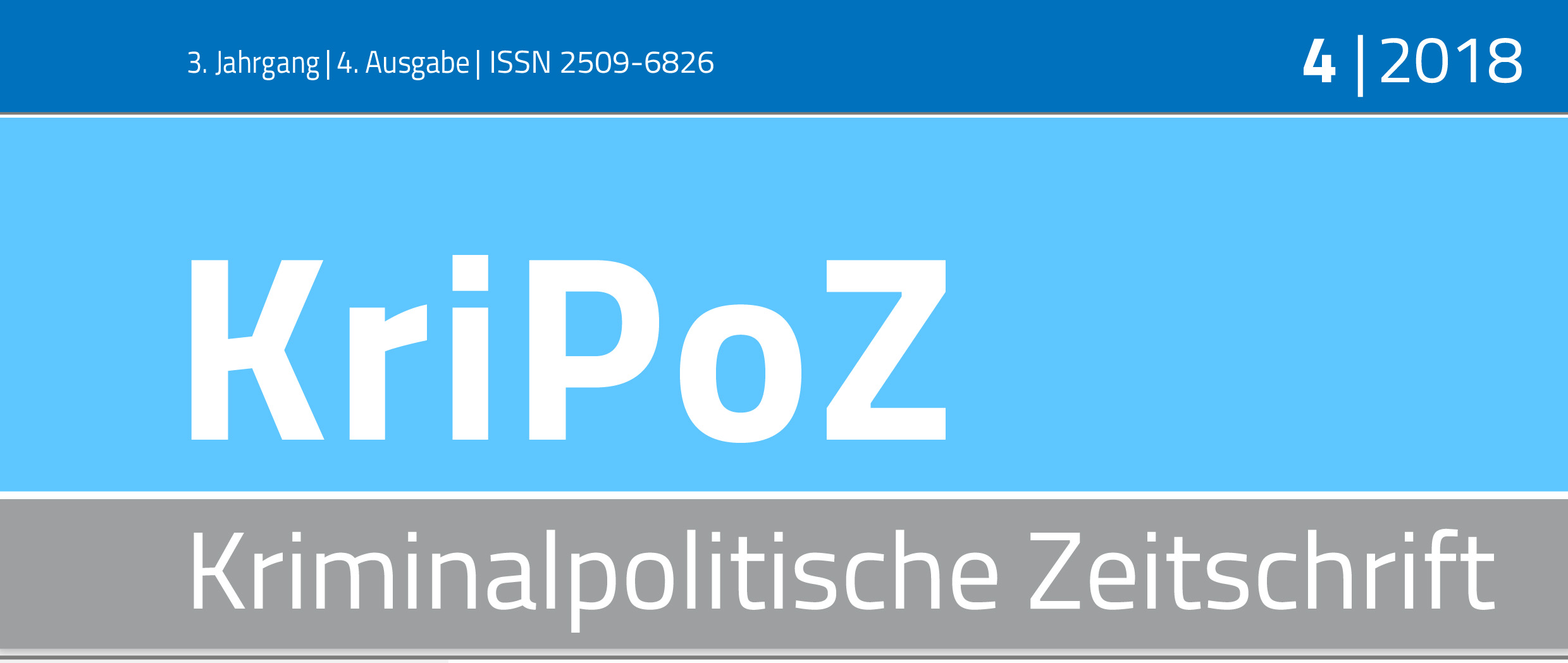Abstract
Deutschen Strafgerichten wird immer wieder der Vorwurf gemacht, zu milde und zu „täterfreundlich“ zu urteilen. Der vorliegende Beitrag nimmt Form, Inhalt und Folgen der öffentlichen Kritik an gerichtlichen Strafzumessungsentscheidungen näher in den Blick. Grundlage der Betrachtungen ist eine Inhaltsanalyse von fast 2000 Nutzerkommentaren zu Medienberichten über Sexual-, Wirtschafts- und Gewaltdelikte. Die Untersuchung gibt Aufschluss darüber, welche Aspekte der Strafzumessung auf Unverständnis in der Bevölkerung stoßen: Gegenstand der Kritik sind etwa die vermeintlich fehlende Berücksichtigung von Opferinteressen, der Verzicht auf die Ausschöpfung von Strafrahmen sowie die Aussetzung von Strafen zur Bewährung. Die Analyse zeigt ferner, dass Kriminalität und Strafurteile zu einem Politikum geworden sind: Die Empörung über ein als gering empfundenes Strafmaß ist regelmäßig Anlass für eine generelle Ablehnung des deutschen Justizsystems sowie der „Flüchtlingspolitik“ der Bundesregierung. Der Beitrag erörtert mögliche Gründe für die kritische Wahrnehmung der Strafzumessungsentscheidungen und thematisiert anschließend Wege, um Diskrepanzen zwischen den Strafentscheidungen von Richtern und den Straferwartungen von Teilen der Bevölkerung zu überwinden. Eine wichtige Rolle können dabei „Sentencing Guidelines“ spielen, die eine einheitliche und für die Öffentlichkeit transparentere Strafzumessung ermöglichen.
Sabine Horn
Verbot der Gesichtsverhüllung während der Gerichtsverhandlung
Gesetzentwürfe:
- Gesetzesantrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern: BR Drs. 408/18
- Empfehlungen der Ausschüsse: BR Drs. 408/1/18
- Gesetzentwurf des Bundesrates: BT Drs. 19/6287
Mitte Juni 2017 hat der Gesetzgeber bereichsspezifische Regelungen zur Gesichtsverhüllung getroffen (BGBl I 2017, S. 1570). So dürfen beispielsweise Beamt*innen und Soldat*innen bei Ausübung ihres Dienstes ihr Gesicht nicht verhüllen. Aber auch im Wahl-, Personalausweis-, Ausländer- und Straßenverkehrsrecht sind entsprechende Regelungen geschaffen worden. Eine bundeseinheitliche Regelung zur Gesichtsverhüllung in der Gerichtsverhandlung gibt es bislang jedoch nicht.
Daher brachten die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern am 21. September 2018 einen Gesetzesantrag für ein Verbot der Gesichtsverhüllung während der Gerichtsverhandlung in den Bundesrat ein (BR Drs. 408/18). Der Gesetzentwurf setzt einen Beschluss der Justizministerkonferenz aus Juni 2018 um. Der Bundesrat hatte die Bundesregierung bereits 2016 aufgefordert, die Implementierung einer entsprechenden gesetzlichen Regelung zu prüfen. Die Bundesregierung hat sich allerdings bis dato noch nicht dazu geäußert.
Derzeit gibt nur § 176 GVG (Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung) dem Richter die Möglichkeit, eine Entfernung der Verhüllung anzuordnen. Auch durch die Rechtsprechung hat sich noch keine einheitliche Handhabung in Bezug auf Gesichtsverschleierungen in der Gerichtsverhandlung herausgebildet. Bei gleichen oder ähnlich gelagerten Sachverhalten habe es sowohl die Hinnahme der Verhüllung über Maßnahmen zur Identitätsfeststellung bis hin zu einem Verbot gegeben. Die bayerischen und nordrhein-westfälischen Gerichte erwarten aufgrund der Zahl von Zuwanderern aus Kulturkreisen, in denen eine Verschleierung üblich ist, ein vermehrtes Auftreten solcher Fallkonstellationen in der Praxis. Daher sei die Schaffung einer rechtssicheren Regelung geboten.
Das Gerichtsverfassungsgesetz soll daher um eine Regelung erweitert werden, wonach die an der Verhandlung beteiligten Personen ihr Gesicht während der Sitzung nicht verhüllen dürfen. Zwar bedeute dies für eine Frau, die üblicherweise eine Verschleierung trägt, einen Eingriff in das Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 GG). Dieser Eingriff sei aber zur Aufrechterhaltung der im Rechtsstaatsprinzip verankerten Funktionsfähigkeit der gerichtlichen Verhandlung und Kontrolle (Art. 20 Abs. 3, 92 GG) geboten. Auch die Mimik der beteiligten Personen müsse das Gericht als Erkenntnismittel bei der Aufklärung des Sachverhaltes ausschöpfen können. Eine Ausnahmeregelung sei aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht geboten. Lediglich im Falle besonders gefährdeter Prozessbeteiligter oder Opfer von Säure-Attacken könne eine Ausnahme gemacht werden.
Im Anschluss an die Sitzung wurde der Gesetzesantrag an den Rechts- und an den Innenausschuss überwiesen. Nach ihrer Empfehlung wird der Antrag zur Abstimmung wieder auf die Tagesordnung gesetzt (BR Drs. 408/1/18). In seiner Plenarsitzung am 19. Oktober 2018 hat der Bundesrat den Entwurf schließlich beschlossen und der Bundesregierung zwecks Gegenäußerung zugeleitet. Am 10. Dezember 2018 wurde der Entwurf in den Bundestag eingebracht (BT Drs. 19/6287).
Protest Policing im Wandel? Konservative Strömungen in der Politik der Inneren Sicherheit am Beispiel des G20-Gipfels in Hamburg
von Dr. Daniela Hunold und Wiss. Mit. Maren Wegner
Abstract
Der G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 wurde zum Medienereignis, jedoch weniger wegen der Ergebnisse des Gipfels oder der Großdemonstrationen, sondern aufgrund der gewaltförmigen Eskalationen im Laufe der Protestwoche. Eine emotionale öffentliche Diskussion schloss sich an, u.a. über die Frage nach dem politischen (Nicht-)Gehalt der Riots. Schnell wurden Maßnahmen gegen die linksradikale Szene und autonome Zentren gefordert. Starke Kritik erfuhr auch die Polizei angesichts einer großflächigen Protestverbotszone, der konsequenten Verhinderung von Protestcamps und wegen vieler dokumentierter Fälle illegaler Polizeigewalt.
Androiden und die Renaissance der strengen Schuldtheorie?
Abstract
Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung haben sich im vorherigen Jahrhundert intensiv mit der Behandlung des Sachverhaltsirrtums bezüglich eines Rechtfertigungsgrundes beschäftigt. Der Gesetzgeber hat (bewusst) davon abgesehen, die Rechtsnatur eines solchen Irrtums festzulegen. Der Beitrag geht der Frage nach, ob die bisherigen Lösungsvorschläge geeignet sind, den technologischen Fortschritt angemessen zu berücksichtigen.
The Rights of the Children in Turkish Criminal Justice System
von Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri
Abstract
The Turkish legal system follows the civil law tradition of the continental Europe, which has its origin in the Roman Law. Turkey has made last 15 years major legal reforms. After new penal code and criminal procedure code the juvenile courts Law has been replaced by the child protection Law which entered into force on 3.7.2005. Protection of the rights of children in criminal justice system, the main elements of new turkish children criminal law and problems in praxis have been discussed in the article.
Thomas Kahler: Massenzugriff der Staatsanwaltschaft auf Kundendaten von Banken zur Ermittlung von Internetstraftaten
von OStA Dieter Kochheim
2017, Nomos Verlag, Baden-Baden, ISBN 978-3-8487-3978-3, S. 193, Euro 49.
Die von Prof. Dr. Cornelius Prittwitz und Prof. Dr. Dres. hc Spiros Simitis betreute Studie (S. 7)[1] nimmt den Beschluss des BVerfG vom 17.2.2009[2] zum Anlass, die verfassungs- und europarechtliche Anwendungsweite der Ermittlungsgeneralklausel des § 161 Abs. 1 StPO[3] zu prüfen, die die Staatsanwaltschaft zu „Ermittlungen jeder Art ermächtigt, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln“. Ihm liegt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle wegen des Verdachts des Sich-Verschaffens kinderpornografischer Abbilder im Zusammenhang mit einem kostenpflichtigen Internetangebot aus dem Jahr 2006 zugrunde (Aktion Mikado):[4] „Für den Zugang zu der Internetseite mussten 79,99 $ per Kreditkarte gezahlt werden. Die Staatsanwaltschaft … schrieb daher die Institute an, die Master Card- und Visa-Kreditkarten in Deutschland ausgeben, und forderte sie auf, alle Kreditkartenkonten anzugeben, die seit dem 1. März 2006 eine Überweisung von 79,99 $ an die philippinische Bank aufwiesen, über die der Geldtransfer für den Betreiber der Internetseite abgewickelt wurde. Anschließend teilte die Staatsanwaltschaft noch die zwischenzeitlich bekannt gewordene „Merchant-ID“, die dem Zahlungsempfänger durch die Bank zugewiesene Ziffernfolge, für den Betreiber der Internetseite mit. Die Unternehmen übermittelten der Staatsanwaltschaft daraufhin die erbetenen Informationen … Insgesamt wurden so 322 Karteninhaber ermittelt.“ Hierzu mussten – laut Kahler – die Kreditkartenkartenunternehmen auf „rund 22 Mio. Kreditkartenkonten zugreifen, um Verdächtige nach bestimmten Suchkriterien auszusondern“ (S. 17[5]).
Juliane Klug: Der Gewaltschutzdiskurs und Stalking im Spannungsfeld von Kernstrafrecht und Kriminalprävention. Entwicklungslinien opferorientierter Kriminalpolitik
2017, Verlag Kovač, Hamburg, ISBN: 978-3-8300-9412-8, S. 485, Euro 129,80.
Die Arbeit von Klug wurde 2016 an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. Dies macht deutlich, dass die bereits in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen des Straftatbestands der Nachstellung gem. § 238 StGB keine Berücksichtigung finden konnten. Wer der Meinung ist, dadurch habe sich die Dissertation von Klug quasi überholt, liegt allerdings falsch. Etwas unverständlich ist jedoch der Hinweis im Vorwort, dass bei der Bearbeitung Gesetzesänderungen, laufende Gesetzgebungsverfahren, geplante Reformvorhaben sowie Rechtsprechung und statistische Erhebungen bis Dezember 2014 berücksichtigt wurden. Warum trotz Einreichung der Dissertation im Jahr 2016 ein ganzes Jahr ausgespart wurde und in der Literaturverarbeitung keine Berücksichtigung fand, erschließt sich nicht.
Volker Bützler: Staatsschutz mittels Vorfeldkriminalisierung. Eine Studie zum Hochverrat, Terrorismus und den schweren staatsgefährdenden Gewalttaten
2017, Nomos, Baden-Baden, ISBN: 978-3-8487-4086-4, S. 294, Euro 79,00.
Die zunehmende Vorfeldkriminalisierung durch den deutschen Gesetzgeber, die Entwicklung von einem Schuldstrafrecht hin zu einem Sicherheitsrecht und Gefährdungsstrafrecht ist mittlerweile in zahlreichen Dissertationen und Habilitationen beschrieben worden. Insoweit muss sich eingangs die kritische Frage gestellt werden, ob es einer weiteren Dissertation bedarf. Gerade zum Bereich Vorfeldkriminalisierung und Terrorismusstrafrecht gibt es bereits so zahlreiche Monografien, das sie nicht alle in der vorliegenden Dissertation zitiert wurden. Zudem ist die Dissertation im Wintersemester 2016/2017 angenommen worden, so dass sich zumindest die Ausführungen zum Vereinigungsbegriff durch die im Juli 2017 in Kraft getretene Legaldefinition in § 129 Abs. 2 StGB überholt haben (BGBl I 2017, 2440).
Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
Gesetzentwürfe:
- Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen
- Regierungsentwurf, BR Drs. 372/18, BT-Drs. 19/4455
- Empfehlungen der Ausschüsse: BR Drs. 372/1/18 (vom 11.9.2018)
- Empfehlungen der Ausschüsse zu BR Drs. 372/1/18 (vom 12.9.2018)
Der Onlinehandel, bei dem Betreiber von elektronischen Marktplätzen aus dem Inland, der Europäischen Union oder einem Drittland Waren anbieten, nimmt mehr und mehr zu. Immer wieder gibt es in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte dafür, dass es dabei zu Umsatzsteuerhinterziehungen kommt. Mit dem Gesetzentwurf soll dies nun verhindert werden.
Die Betreiber der elektronischen Marktplätze sollen daher verpflichtet werden, bestimmte Daten ihrer Nutzer vorzuhalten und für entstandene und nicht abgeführte Umsatzsteuer aus Umsätzen auf ihrem Marktplatz zu haften.
Des Weiteren gibt es in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendigen Gesetzgebungsbedarf, dem nun entsprochen werden soll.
Am 1. August 2018 hat das Bundeskabinett dem vom Bundesministerium der Finanzen vorgelegten Referentenentwurf beschlossen. Das Gesetz soll bereits im Januar 2019 umgesetzt werden. Parallel werden europäische Maßnahmen erarbeitet, die aber erst im Jahr 2021 wirksam werden könnten.
Am 21. September 2018 beriet der Bundesrat in seiner Plenarsitzung über den Gesetzentwurf und unterstützt ausdrücklich die geplanten Änderungen des Umsatzsteuergesetzes zur Bekämpfung des Betrugs beim Onlinehandel. Insgesamt sollen 15 Steuergesetze an EU-Recht und an die höchstrichterliche Rechtsprechung angepasst werden. Die Ausschüsse für Finanzen, Inneres, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft haben 39 Empfehlungen erarbeitet und sprechen sich dafür aus, zu dem Entwurf detailliert Stellung zu nehmen (BR Drs. 372/1/18). Die meisten Änderungswünsche befassen sich mit den vorgeschlagenen Änderungen entsprechender Steuergesetze rund um die Dienstwagenbesteuerung. Hinsichtlich des Onlinehandels unterstützen der Finanz- und der Wirtschaftsausschuss grundsätzlich den Vorschlag der Bundesregierung, unterbreiten aber detaillierte Änderungsvorschläge, um die Regelungen praxistauglicher und unbürokratischer zu gestalten.
Am 26. September 2018 war der von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf (BT Drs. 18/4455) auch Thema der Sitzung des Finanzausschusses des Bundestages.
Die Fraktionen der FDP und CDU/CSU kritisierten, dass die Onlinehändler nunmehr gezwungen werden mit Papier-Bescheinigungen zu arbeiten. Ebenfalls äußerte sich die Fraktion CDU/CSU hinsichtlich der Regelungen zur Haftung kritisch. Auf Nachfrage der AfD-Fraktion, verwies die Bundesregierung bezüglich der Steuerausfälle auf eine Angabe des Bundesrates, nachdem es sich bei den Mindereinnahmen um ca. 1 Mrd. Euro handeln soll. Schätzungen belaufen sich auf Steuerausfälle in der EU auf ca. 50 Mrd. Euro. Zur weiteren Klärung der aufgeworfenen Fragen beschloss der Finanzausschuss am 15. Oktober 2018 eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Eine Liste der geladenen Sachverständigen und deren Stellungnahmen finden Sie hier.
Am 23. November 2018 stimmte der Bundesrat dem Regierungsentwurf zu. Zahlreiche steuerrechtliche Änderungen werden demnächst umgesetzt. Unter anderem haften künftig die Betreiber eines elektronischen Marktplatzes für nicht entrichtete Umsatzsteuer aus dem Handel auf der jeweiligen Plattform. Eine Haftungsbefreiung ist nur möglich, wenn gewisse Aufzeichnungspflichten erfüllt oder steuerunehrliche Händler von der Plattform ausgeschlossen werden. Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet.