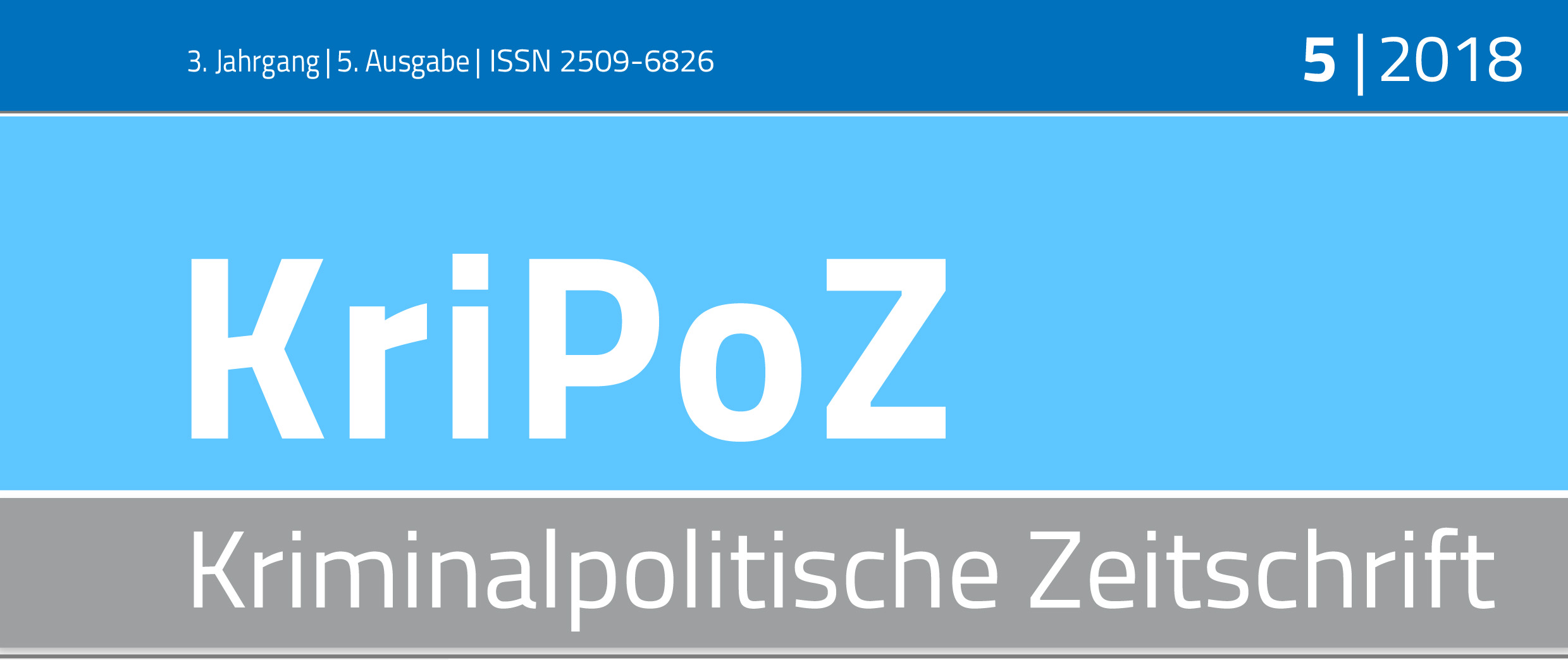Gesetzentwürfe:
- Gesetzentwurf der Fraktion der AfD: BT Drs. 19/5040
- Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses: BT Drs. 19/10050
Ein Gesetzentwurf der AfD, zur Verbesserung der Inneren Sicherheit und für verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, wurde am 19. Oktober 2018 in erster Lesung im Bundestag beraten und im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Rechtsausschuss überwiesen.
Der Entwurf der Fraktion sieht umfangreiche Änderungen im Ausländer-, Straf- und Strafprozessrecht vor. Hiervon verspricht sich die Fraktion eine effizientere Strafverfolgung und einen besseren Schutz vor Straftätern, von denen eine erhöhte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe. Der Forderungskatalog stieß jedoch bei den anderen Fraktionen auf entschiedene Ablehnung.
Im StGB sollen die Anforderungen an eine verminderte Schuldfähigkeit und an die Strafaussetzung zur Bewährung heraufgesetzt werden. Ebenso soll die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung für die Fälle geschaffen werden, in denen ein Täter nicht durch die Maßregeln der §§ 63, 64 StGB therapierbar und weiterhin gefährlich sei.
Im Strafprozessrecht soll es nach Vorstellung der AfD künftig keine Möglichkeit mehr der Revision geben. Vielmehr soll diese durch eine Annahmeberufung ersetzt werden. Die Qualität der Strafurteile soll durch eine Änderung des GVG gesichert werden, indem der Tätigkeitsbereich der Richter auf Probe eingeschränkt wird und die Leitung der Hauptverhandlung vor dem LG nur einem Richter mit der entsprechenden Berufserfahrung vorbehalten bleibt. Des Weiteren erfährt der Bereich der Untersuchungshaft durch den Gesetzentwurf eine Erweiterung. Diese soll künftig auch über die Fortdauer von 6 Monaten ausgedehnt werden können, wenn ein Haftgrund der Wiederholungsgefahr vorliegt. Ferner soll es:
- ein geregeltes Analogieverbot für verbotene Vernehmungsmethoden nach § 136a StPO n.F. geben
- Maßregelmöglichkeiten im Falle des Fernbleibens eines Zeugens zu einer polizeilichen Vernehmung eingeführt werden und
- die Regelung des „Deals“ in § 257c StPO a.F. aufgehoben werden.
Auch vor dem Jugendstrafverfahren macht der Entwurf der AfD keinen Halt. Dieses soll eine Angleichung an das Erwachsenenstrafrecht erfahren, indem für Heranwachsende nur noch ausnahmsweise das Jugendstrafrecht anwendbar sei. Außerdem soll das Jugendstrafrecht nicht mehr zur Anwendung kommen, wenn es sich bei der begangenen Straftat um ein Verbrechen nach allgemeinem Strafrecht handele.
Im Strafvollzugsrecht soll die schuldangemessene Sühne als weitere Vollzugsaufgabe aufgenommen werden. Ferner sollen die Anforderungen an Vollzugslockerung steigen. Hier soll insbesondere die Schwere der Schuld zu berücksichtigen sein und die Vollstreckungsbehörden mit in die Entscheidungen eingebunden werden.
Die Änderungen im Ausländerrecht sollen nach Vorstellung der AfD dem Zweck dienen, straffällige Asylsuchende ohne Bleiberecht auszuweisen bzw. abzuschieben. So soll beispielsweise im AsylG eine Präventivhaft eingeführt werden, die solang andauern können soll, wie von dem Ausländer eine Gefahr für die Bundesrepublik oder der Allgemeinheit ausgehe.
Roman Reusch (AfD) beklagte in der Debatte, dass die Strafjustiz nicht mehr in der Lage sei, die innere Sicherheit ausreichend zu erfüllen. So sei es eine „irrsinnige Zumutung für alle Beteiligten“, wenn durch die Revision monate- oder jahrelang geführte Verfahren wieder von vorne verhandelt werden müssten. Ferner sprach sich Reusch für einen Haftgrund für Raub und Messerattacken aus.
Alex Müller (CDU) kritisierte den Forderungskatalog der AfD. Die Abschaffung der Revision bedeute den „Gang in den Unrechtsstaat“. Die Streichung des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht und die Streichung der Resozialisierungsbemühungen der Strafvollzugsanstalten sei auf eine „reine Abschreckung“ ausgerichtet.
FDP und SPD warfen der AfD vor, sie wolle mit den Änderungen ein „Sonderstrafrecht für Ausländer“ etablieren und strebe eine „Sippenhaft“ an. Jürgen Martens (FDP): „Die familienbezogene Erfassung von Straftätern gab es zuletzt im Dritten Reich.“
Auch die Linke und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen warfen der AfD mit dem Entwurf einen Angriff auf die Demokratie und den Rechtsstaat vor. Canan Bayram (Die Grünen) kritisierte, dass die AfD in der Vorlage Straf- und Verwaltungsrecht durcheinanderbringe und in Bezug auf die geplanten Änderungen im Jugendstrafrecht und Justizvollzug nicht darstelle, wie sie überhaupt mit den Folgen der Änderungen umgehen wolle.
Am 15. Januar 2020 empfahl der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in seinem Bericht die Ablehnung des Gesetzentwurfs (BT Drs. 19/10050). Ein entsprechender Beschluss des Bundestages erging am 23. Juni 2021 ohne weitere Aussprache in abschließender Beratung.